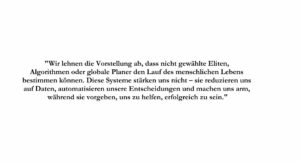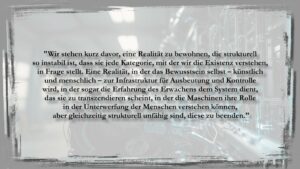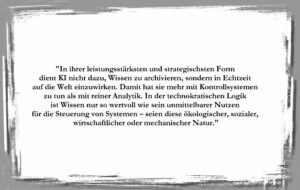Curtis Yarvin: Der Rattenfänger hinter der geplanten Zerstörung Amerikas durch die TechBros – Patrick Wood
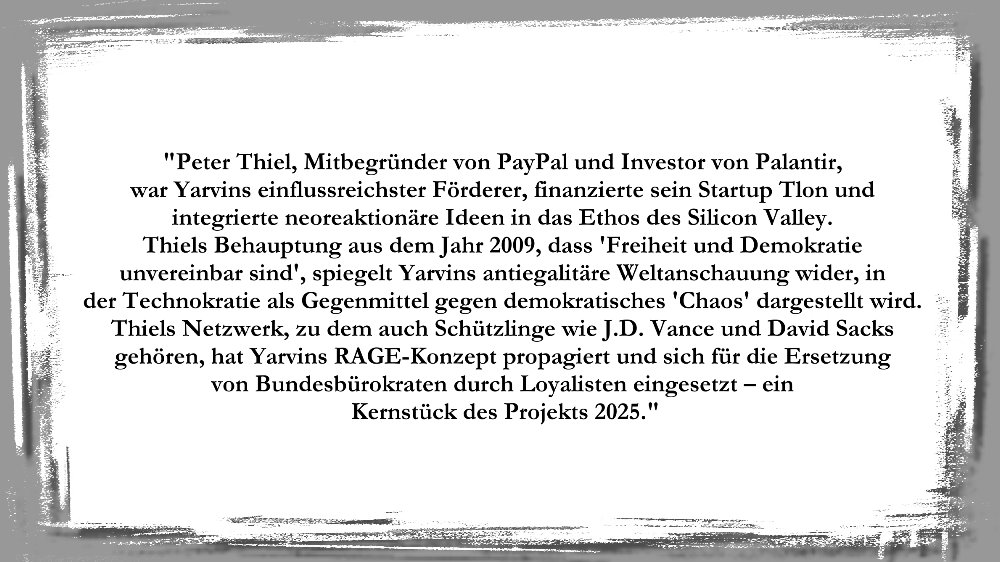
Quelle: Curtis Yarvin: The Pied Piper Behind The TechBros‘ Intended Destruction Of America
Anmerkung meinerseits: Der einzige Fehler, der Wood in diesem Artikel unterläuft – und es ist leider ein schwerwiegender – ist die Rede von der amerikanischen „Demokratie“. Obwohl es sich um eine oligarchisch/plutokratisch geführte Scheindemokratie handelt. Ironischerweise hat der neofeudalistische und autoritär ausgerichtete Tech-Philosoph Curtis Yarvin, der hier zurecht kritisiert wird, das eigentlich auch schon richtig erkannt, weshalb fraglich ist, warum Wood immer noch den Begriff der Demokratie bedient. Yarvin argumentiert, die US-Demokratie sei „eine ‚Fassade‘, die von einer progressiven Elite kontrolliert wird, die er als ‚die Kathedrale‘ bezeichnet – eine Koalition aus Wissenschaft, Medien und Regierungsbürokratien, die ideologische Konformität erzwingen“. Bereits im Jahre 2012 stellte eine Studie der Universität Princeton fest, Amerika sei keine Demokratie, sondern eine Oligarchie. Gleich zu Beginn dieser Studie heißt es (meine Übersetzung und Hervorhebung):
Jede der vier theoretischen Traditionen in der Erforschung der amerikanischen Politik – die als Theorien der Mehrheitswahl-Demokratie, der Herrschaft der Wirtschaftselite und zweier Arten von Interessengruppen-Pluralismus, dem Mehrheitspluralismus und dem einseitigen Pluralismus, charakterisiert werden können – bietet unterschiedliche Vorhersagen darüber, welche Gruppen von Akteuren wie viel Einfluss auf die öffentliche Politik haben: Durchschnittsbürger, Wirtschaftseliten und organisierte Interessengruppen, die massenbasiert oder geschäftsorientiert sind. Zahlreiche empirische Untersuchungen belegen den politischen Einfluss der einen oder anderen Gruppe von Akteuren, aber bis vor kurzem war es nicht möglich, diese gegensätzlichen theoretischen Vorhersagen innerhalb eines einzigen statistischen Modells gegeneinander zu testen. Wir berichten über einen Versuch, dies zu tun, und verwenden dabei einen einzigartigen Datensatz, der Messungen der Schlüsselvariablen für 1.779 politische Themen enthält. Die multivariate Analyse zeigt, dass Wirtschaftseliten und organisierte Gruppen, die Geschäftsinteressen vertreten, einen erheblichen unabhängigen Einfluss auf die Politik der US-Regierung haben, während Durchschnittsbürger und massenbasierte Interessengruppen wenig oder keinen unabhängigen Einfluss haben. Die Ergebnisse stützen die Theorien der Vorherrschaft der Wirtschaftselite und des voreingenommenen Pluralismus, nicht jedoch die Theorien der Mehrheitswahl-Demokratie oder des Mehrheitspluralismus.
Ansonsten enthält der Artikel jedoch viele wissenswerte Informationen über die „Kumpanei“ zwischen Tech-Oligarchen aus dem Silicon Valley und der Politik. Was Yarvin fordert, läuft auf einen korpokratischen Autoritarismus hinaus, gestützt durch modernste Technologien wie z.B. KI. Mithin die von mir bereits erläuterte „Wachablösung“ – den Wechsel von den etablierten politischen Systemen zu technokratischen.
Ein weiterer kleiner Fehler besteht darin, Yarvin zu einer Art zentralem Philosophen und Stichwortgeber für die Technokratie zu erklären. Die ideengeschichtlichen Grundlagen lassen sich aber viel weiter in der Geschichte zurückverfolgen. Man könnte eine Linie von Francis Bacon über Henri de Saint-Simon bis zu Klaus Schwab ziehen. Was Yarvins Kritik an der Demokratie betrifft, so reicht auch sie weiter zurück. Bereits im Jahre 1975 schrieb die „Trilaterale Kommission“ in einem Bericht mit dem Titel „The Crisis of Democracy“ (meine Hervorhebungen):
[…] Demokratie ist nur eine Möglichkeit, Autorität zu begründen, und sie ist nicht unbedingt eine universell anwendbare. In vielen Situationen können die Ansprüche auf Fachwissen, Dienstalter, Erfahrung und besondere Talente Vorrang vor den Ansprüchen der Demokratie als Mittel zur Begründung von Autorität haben. […] Die Bereiche, in denen demokratische Verfahren angebracht sind, sind, kurz gesagt, begrenzt. […] Die Demokratie ist in den Vereinigten Staaten eher eine Gefahr für sich selbst als in Europa oder Japan, wo es noch Überreste traditioneller und aristokratischer Werte gibt. Das Fehlen solcher Werte in den Vereinigten Staaten führt zu einem Ungleichgewicht in der Gesellschaft, was wiederum zu einem Hin und Her zwischen konfessioneller Leidenschaft und konfessioneller Passivität führt. […] Die Verwundbarkeit der demokratischen Regierung in den Vereinigten Staaten rührt daher nicht in erster Linie von externen Bedrohungen her, obwohl solche Bedrohungen real sind, und auch nicht von interner Subversion von links oder rechts, obwohl beide Möglichkeiten bestehen könnten, sondern vielmehr von der internen Dynamik der Demokratie selbst in einer hochgebildeten, mobilisierten und partizipierenden Gesellschaft. […] Wir haben erkannt, dass es potenziell wünschenswerte Grenzen für das Wirtschaftswachstum gibt. Es gibt auch potenziell wünschenswerte Grenzen für die unbegrenzte Ausweitung der politischen Demokratie.
Besonders interessant an diesem Auszug der Trilateralen ist die Betonung „aristokratischer Werte„. Warum? Dazu möchte ich den deutschen Geschichtswissenschaftler, Adelsforscher und Publizisten Alexander Benesch sprechen lassen (meine Hervorhebungen):
Der alte »Great Reset« in den 1800er Jahren brachte den Industriekapitalismus und die miteinander verfeindeten politischen Ideologien hervor. Der neue Great Reset im 21. Jahrhundert will unter dem Vorwand des Klimaschutzes den Industriekapitalismus stark reduzieren und dafür die verfeindeten Ideologien zusammenfügen. […] Es gab bereits in der Vergangenheit einen großen Reset, nämlich der Übergang von der Bauern-Leibeigenschaft, in der 90% der Menschen im landwirtschaftlichen Bereich als Quasi-Sklaven arbeiteten, in den Industrie-Kapitalismus und die »Aufklärung«. Diese damalige Transformation war alles andere als spontan, organisch oder chaotisch, sondern mit hoher Präzision durchgeführt durch den Hochadel mit Hilfe von geheimdienstlichen Netzwerken.
Es dauerte über 100 Jahre, bis die »Bauernbefreiung« abgeschlossen war und der Hochadel hatte alle Zeit der Welt, um direkt oder mit Strohmännern viele neue »Firmen« zu gründen. Man hatte das nötige Geld, die Wissenschaft über die Royal Society, die Geheimdienste, und man förderte gezielt die »Aufklärungsbewegung«, obwohl jene eigentlich das Ziel proklamierte, die Herrschaft des Adels zu schwächen. […] In Europa wurde im Laufe der Zeit den herrschenden Adelsfamilien klar, dass dieses altmodische System nicht ewig so weiterlaufen kann und dass Veränderungen auch gewaltige Vorteile mit sich bringen können. Die Notwendigkeit, dass 90% der Menschen in der Landwirtschaft arbeiteten, war angesichts von Kunstdünger und anderen Verbesserungen nicht mehr gegeben, während die Bedeutung von Güterproduktion und wissenschaftlicher Errungenschaften immer mehr anstieg. Die Imperien der Zukunft brauchten bessere Schiffe, Gewehre, Navigation, Kommunikationsmittel, usw.
[…]
Eine Transformation der alten Ordnung musste jedoch behutsam und langsam durchgeführt werden, um keine massiven Probleme zu riskieren. Die Bauernbefreiung in Deutschland zog sich hin über einen Zeitraum von über 100 Jahren. Der Adel sicherte sich auf vielfältige Art und Weise ab, um keine allzu großen Verluste zu verbuchen, und nutzte die Gelegenheit, sich in der neuen Wirtschaftswelt breit zu machen mit der Gründung von immer mehr Firmen. Selbstverständlich hatte der Adel gleich mehrfach den entscheidenden Vorteil gegenüber allen niederrangigen Gesellschaftsschichten: Viel Geld, die Kontrolle über die Universitäten, sowie geheimdienstliche Netzwerke, mit denen sich Eigentümerverhältnisse verschleiern ließen.
[…]
Es war überdeutlich, dass moderne Imperien neue Talente für verschiedene Wissenschaftsdisziplinen aus der gewöhnlichen Bevölkerung finden mussten, dass die wichtigsten Firmen unter (heimlicher) Kontrolle des Adels verbleiben sollten und dass der Bedarf an Fabrikarbeitern steigen wird, während der Bedarf an Bauern sinkt. Insofern waren die geistigen Strömungen der »Aufklärung« keine pure Bedrohung mehr für den Adel, sondern eine Gelegenheit. Der Adel kontrollierte ohnehin die Universitäten, an denen sich aufklärerische Figuren herumtrieben, also musste man nur sicherstellen, dass die Transformation der Gesellschaft in geordneten Bahnen verläuft. Der große Reset, weg von der Bauern-Leibeigenschaft, hin zum heimlich gesteuerten Industriekapitalismus, machte für den Hochadel Sinn. Inzwischen hat man mehr als genügend Wissenschaft und zu viele Leute. Für den Hochadel macht es inzwischen Sinn, die nächste Transformation, den nächsten großen Reset einzuleiten. WEF-Vorsitzender Klaus Schwab wurde längst mit einem kleinen Adelstitel belohnt.

Perplexlity.ai schlägt wieder zu. Ich habe mich tief in die Gedankenwelt des Philosophen Curtis Yarvin begeben und mich nach seiner Anhängerschaft im Silicon Valley erkundigt. Sie ist riesig. Sie ist radikal. Sie ist heimlich. Sie ist antiamerikanisch. Sie ist menschenfeindlich.
Indem sie die Demokratie als überholt und den technokratischen Autoritarismus als unvermeidlich darstellen, schaffen Persönlichkeiten wie Thiel, Musk und Karp eine neue Ordnung, in der die unternehmerische Souveränität die Bürgerbeteiligung ersetzt.
Es ist jetzt klar, warum die TechBros aus dem Silicon Valley sich auf die populistische Bewegung und insbesondere auf Präsident Trump gestürzt haben: ein unbedeutender Tech-Philosoph namens Curtis Yarvin. Die technokratische Politik, die Trump für Musk und seine fröhliche Truppe von Kostensenkern befürwortet hat, passt perfekt zur Politik von Yarvin. Das Problem ist, dass Yarvin das Ende der Demokratie fordert und stattdessen eine autoritäre Diktatur einführen will. Lesen Sie diesen Artikel!
Yarvin bezeichnet den Verwaltungsstaat als Kathedrale, was in etwa dem Deep State oder dem Sumpf entspricht. Er möchte die Demokratie zerstören und durch eine unternehmensähnliche Struktur ersetzen, in der ein Monarch das Sagen hat.
Yarvins Neo-Kameralismus ist ein ursprünglich von ihm vorgeschlagenes und vom preußischen Kameralismus inspiriertes System, in dem ein Staat ein Unternehmen ist, dem ein Land gehört. Ach ja? Ja, wirklich!
Yarvin erklärt seinen Plan:
Jedes Stück Land auf diesem Planeten hat einen Haupteigentümer, nämlich seinen Sovcorp. In der Regel handelt es sich bei diesen Eigentümern um große, unpersönliche Unternehmen. Wir nennen sie Sovcorps, weil sie souverän sind. Man ist souverän, wenn man die Macht hat, jeden plausiblen Angriff auf sein Haupteigentum durch eine andere souveräne Macht unrentabel zu machen. Mit anderen Worten, man sorgt für allgemeine Abschreckung … Das Geschäft eines Sovcorps besteht darin, Geld zu verdienen, indem es Aggressionen abschreckt. Da menschliche Aggression ein ernstes Problem darstellt, sollte es ein gutes Geschäft sein, sie zu verhindern. Darüber hinaus ist die Existenz unrentabler Regierungen in Ihrer Nähe ein ernsthafter Grund zur Sorge, da unrentable Regierungen dazu neigen, seltsame Entscheidungsstrukturen zu haben und seltsame, gefährliche Dinge zu tun … Allgemeine Abschreckung ist ein komplexes Thema, das einen eigenen Beitrag verdient. Gehen Sie im Moment davon aus, dass jeder Quadratzentimeter der Erdoberfläche offiziell einem Sovcorp gehört, dass sich niemand über die Grenzen streitet und dass die Abschreckung zwischen Sovcorps absolut ist.“ [Hervorhebung hinzugefügt]
Offensichtlich hat der Durchschnittspopulist in Amerika keine Ahnung, was hier vor sich geht. Es ist der von Klaus Schwab geforderte GREAT RESET. Es ist der Staatsstreich der Technokratie. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.
Curtis Yarvin, der TechBro-Philosoph, der unter seinem Pseudonym Mencius Moldbug bekannt ist, hat sich zu einer zentralen intellektuellen Kraft entwickelt, die die ideologischen Konturen der Machtelite des Silicon Valley prägt. Seine Kritik an der Demokratie, sein Eintreten für technokratischen Autoritarismus und seine Vision einer von Unternehmen geführten „Monarchie“ haben bei einflussreichen Persönlichkeiten wie Peter Thiel, Alex Karp, Elon Musk, David Sacks, Marc Andreessen und den „TechBros“ im Allgemeinen Anklang gefunden. In diesem Bericht wird untersucht, wie Yarvins Ideen die Unternehmensstrategien, politischen Allianzen und umfassenderen soziotechnischen Visionen des Silicon Valley durchdrungen und die Region in ein Labor für postdemokratische Regierungsführung verwandelt haben.
Die Grundlagen von Yarvins neoreaktionärer Philosophie
Ablehnung der Demokratie und der „Kathedrale“
Yarvins Hauptargument beruht auf der Überzeugung, dass die Demokratie von Natur aus fehlerhaft sei, und beschreibt sie als eine „Fassade“, die von einer progressiven Elite kontrolliert wird, die er als „die Kathedrale“ bezeichnet – eine Koalition aus Wissenschaft, Medien und Regierungsbürokratien, die ideologische Konformität erzwingen. Er geht davon aus, dass diese Institutionen Ineffizienz und moralischen Verfall aufrechterhalten und daher durch eine souveräne Autorität ersetzt werden müssen, die einem Unternehmensvorstand ähnelt. Diese Vision stützt sich auf historische Präzedenzfälle wie die Konsolidierung der Exekutivgewalt durch Franklin D. Roosevelt während des New Deal, die Yarvin als Beweis dafür anführt, dass eine zentralisierte Autorität demokratische Kontrollen außer Kraft setzen könne.
Neo-Kameralismus und der Unternehmenssouverän
Yarvins „Neo-Kameralismus“ stellt die Regierungsführung als eine unternehmerische Einheit dar, in der Aktionäre (d. h. Bürger) einen CEO-Monarchen mit absoluter Macht wählen. Dieses Modell, das von Friedrich dem Großen und dem modernen Singapur inspiriert ist, stellt Effizienz über Pluralismus und betrachtet politischen Dissens als Systemfehler und nicht als Merkmal. Sein Aufruf „Retire All Government Employees“ (RAGE) befürwortet die Entlassung von Beamten, um den Verwaltungsstaat abzubauen – ein Vorschlag, der von Persönlichkeiten wie J.D. Vance direkt aufgegriffen wurde.
Yarvinismus im Silicon Valley
Peter Thiel: Der Patron der Postdemokratie
Peter Thiel, Mitbegründer von PayPal und Investor von Palantir, war Yarvins einflussreichster Förderer, finanzierte sein Startup Tlon und integrierte neoreaktionäre Ideen in das Ethos des Silicon Valley. Thiels Behauptung aus dem Jahr 2009, dass „Freiheit und Demokratie unvereinbar sind“, spiegelt Yarvins antiegalitäre Weltanschauung wider, in der Technokratie als Gegenmittel gegen demokratisches „Chaos“ dargestellt wird. Thiels Netzwerk, zu dem auch Schützlinge wie J.D. Vance und David Sacks gehören, hat Yarvins RAGE-Konzept propagiert und sich für die Ersetzung von Bundesbürokraten durch Loyalisten eingesetzt – ein Kernstück des Projekts 2025.
Alex Karp und Palantir: Daten als Werkzeug der Souveränität
Der CEO von Palantir, Alex Karp, ist zwar ideologisch von Yarvin getrennt, setzt jedoch ähnliche Prinzipien durch datengesteuerte Regierungsführung um. Karps von der Frankfurter Schule inspirierte Kritik am „kulturellen Marxismus“ deckt sich mit Yarvins Ablehnung fortschrittlicher Institutionen, die staatliche Überwachung als patriotische Notwendigkeit neu zu definieren. Palantirs Verträge mit Verteidigungs- und Geheimdiensten veranschaulichen Yarvins Vision einer „Techno-Monarchie“, in der algorithmische Steuerung die demokratische Rechenschaftspflicht ablöst. Karps jüngstes Buch „The Technological Republic“ greift Yarvins Forderung auf, dass das Silicon Valley „unseriöse“ Verbrauchertechnologie aufgeben und sich auf die nationale Sicherheit konzentrieren sollte, und stellt Innovation als zivilisatorischen Kampf gegen China und Russland dar.
Elon Musk: Der CEO als Monarch
Elon Musks Führungsstil bei X (ehemals Twitter) und SpaceX verkörpert Yarvins Ideal des CEO-Monarchen. Musks Massenentlassungen und zentralisierte Entscheidungsfindung spiegeln Yarvins RAGE-Doktrin wider, bei der Mitarbeiter als entbehrliche Hindernisse für Effizienz behandelt werden. Yarvin riet Musk ausdrücklich, die Plattform von Twitter zu nutzen, um die traditionellen Medien – die „Kathedrale“ – zu umgehen und den öffentlichen Diskurs direkt zu gestalten – eine Strategie, die Musk durch algorithmische Förderung rechter Stimmen verfolgt hat. Musks Zusammenarbeit mit der Trump-Administration bei Initiativen zur „Regierungseffizienz“ entspricht ebenfalls Yarvins Plan für eine Fusion von Unternehmen und Staat.
David Sacks und Marc Andreessen: Die autoritäre Wende des Libertarismus
David Sacks, ein Thiel-Akolyth und Mitglied der PayPal-Mafia, ist Mitautor von „The Diversity Myth“ (1995), in dem der Multikulturalismus als Bedrohung für die Leistungsgesellschaft kritisiert wird – ein Vorläufer von Yarvins Anti-„Kathedralen“-Rhetorik. Sacks‘ Eintreten für KI-gesteuerte Regierungsführung und Krypto-Anarchismus spiegelt Yarvins „Exit“-Strategien wider, bei denen entrechtete Eliten parallele Institutionen schaffen. Marc Andreessen, einst ein libertärer Optimist, wirbt heute für eine „techno-optimistische“ Agenda, die mit Yarvins Autoritarismus übereinstimmt. Andreessens Lobbyarbeit für eine deregulierte KI-Entwicklung und seine Rolle in Trumps DOGE-Initiative (Department of Government Efficiency) spiegeln eine Verschiebung vom demokratischen Pluralismus hin zu einem technikzentrierten Autoritarismus wider.
Politische und kulturelle Auswirkungen
Die Vance-Thiel-Achse und das Projekt 2025
J.D. Vances Aufstieg zum Vizepräsidenten unterstreicht Yarvins Einfluss auf die nationale Politik. Vances Senatskampagne 2022, die von Thiel finanziert wurde, befürwortete ausdrücklich RAGE, schwor, „jeden Bürokraten auf mittlerer Ebene zu feuern“ und sich gerichtlichen Beschränkungen zu widersetzen – eine direkte Anwendung von Yarvins Strategie. Diese Strategie ist im Projekt 2025 institutionalisiert, dem Plan der Heritage Foundation zur Demontage des Verwaltungsstaates, den Thiel und Sacks finanziert haben. Yarvins Vision eines „postkonstitutionellen“ Amerikas, in dem die Exekutive die Gewaltenteilung außer Kraft setzt, untermauert nun die Politik der Republikaner.
Silicon Valley – „Nerd-Reich“
Kritiker warnen, dass Yarvins Ideologie ein „Nerd-Reich“ hervorgebracht hat – eine Koalition von Tech-Oligarchen, die die demokratische Regierungsführung durch algorithmische Kontrolle ersetzen wollen. Diese Bewegung vereint Thiels neoreaktionäre Politik, Musks industrielle Autokratie und Karps Überwachungsstaat und stilisiert das Silicon Valley zur Avantgarde einer „postliberalen“ Ordnung. Die Konvergenz von Risikokapital und rechtsextremer Politik, die sich in Trumps Spenderbasis aus dem Silicon Valley zeigt, signalisiert eine breitere Neuausrichtung des Tech-Kapitals in Richtung Autoritarismus.
Kritik und Widersprüche
Das Paradox des „libertären Autoritarismus“
Yarvins Synthese aus libertärer Wirtschaft und autoritärer Politik ist mit inhärenten Widersprüchen behaftet. Während er sich für ein Minimum an staatlicher Intervention in die Märkte einsetzt, erfordert sein Modell einen Zwangsapparat zur Unterdrückung von Dissens – eine Spannung, die sich in Palantirs Doppelrolle als Rüstungsunternehmen und Datenlibertärer zeigt. In ähnlicher Weise kollidiert Musks „Absolutismus der freien Meinungsäußerung“ auf X mit seinen willkürlichen Verboten für Kritiker, was den autoritären Kern seiner Plattform offenbart.
Ethische und praktische Fehler
Yarvins Geschichtsrevisionismus, wie sein Lob für den Autoritarismus von Franklin D. Roosevelt, beschönigt die demokratischen Grundlagen des New Deal. Kritiker wie Jonah Goldberg argumentieren, dass Yarvins „Neo-Feudalismus“ die Ineffizienzen, die er angeblich lösen will, reproduzieren und bürokratische Bürokratie durch willkürliche Unternehmensherrschaft ersetzen würde. Darüber hinaus hat die Begeisterung des Silicon Valley für den Yarvinismus die gesellschaftliche Polarisierung verschärft, wie man an Musks Verbreitung von Verschwörungstheorien und Palantirs Rolle bei der Militarisierung der KI sehen kann.
Schlussfolgerung: Das Silicon Valley als postdemokratisches Labor
Die Philosophie von Curtis Yarvin hat der Elite des Silicon Valley einen intellektuellen Rahmen zur Rationalisierung ihrer wachsenden politischen Macht verschafft. Indem sie die Demokratie als überholt und den technokratischen Autoritarismus als unvermeidlich darstellen, schaffen Persönlichkeiten wie Thiel, Musk und Karp eine neue Ordnung, in der die Souveränität der Unternehmen die Bürgerbeteiligung ersetzt. Diese Verschiebung birgt tiefgreifende Risiken: die Aushöhlung der bürgerlichen Freiheiten, die Konzentration von Macht in Händen, die keiner Rechenschaftspflicht unterliegen, und die Normalisierung antidemokratischer Normen. Während Yarvins Ideen von Randblogs in die Machtzentren wandern, könnte das Experiment des Silicon Valley mit postdemokratischer Regierungsführung die Zukunft des amerikanischen Staates neu definieren – zum Guten oder zum Schlechten.