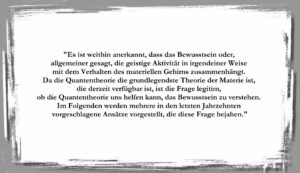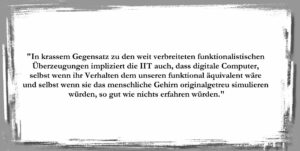Bewusstsein – Robert Van Gulick
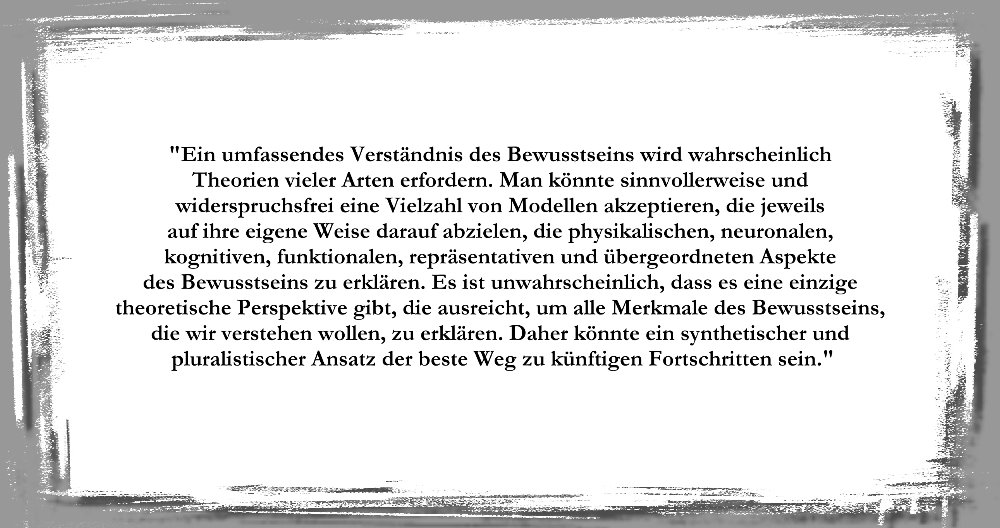
Quelle: Consciousness (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
Vielleicht ist kein Aspekt des Geistes vertrauter oder rätselhafter als das Bewusstsein und unsere bewusste Erfahrung von Selbst und Welt. Das Problem des Bewusstseins ist wohl das zentrale Thema der gegenwärtigen Theorien über den Geist. Obwohl es keine einheitliche Theorie des Bewusstseins gibt, besteht ein weit verbreiteter, wenn auch nicht universeller Konsens darüber, dass eine angemessene Erklärung des Geistes ein klares Verständnis des Bewusstseins und seiner Stellung in der Natur voraussetzt. Wir müssen sowohl verstehen, was Bewusstsein ist, als auch wie es sich zu anderen, unbewussten Aspekten der Realität verhält.
1. Geschichte der Thematik
Die Frage nach der Natur des Bewusstseins wird wahrscheinlich schon so lange gestellt, wie es Menschen gibt. Neolithische Bestattungspraktiken scheinen Ausdruck spiritueller Überzeugungen zu sein und liefern frühe Beweise für zumindest minimal reflektierende Gedanken über die Natur des menschlichen Bewusstseins (Pearson 1999, Clark und Riel-Salvatore 2001). Auch bei präliteraten Kulturen hat man festgestellt, dass sie ausnahmslos irgendeine Form von spiritueller oder zumindest animistischer Auffassung vertreten, die auf ein gewisses Maß an Reflexion über die Natur des Bewusstseins hinweist.
Dennoch haben einige argumentiert, dass das Bewusstsein, wie wir es heute kennen, eine relativ junge historische Entwicklung ist, die irgendwann nach der homerischen Ära aufkam (Jaynes 1974). Nach dieser Ansicht erlebten sich frühere Menschen, einschließlich derer, die im Trojanischen Krieg kämpften, nicht als einheitliche innere Subjekte ihrer Gedanken und Handlungen, zumindest nicht so, wie wir es heute tun. Andere haben behauptet, dass es selbst in der klassischen Periode kein Wort im Altgriechischen gab, das dem „Bewusstsein“ entsprach (Wilkes 1984, 1988, 1995). Obwohl die Alten viel über mentale Angelegenheiten zu sagen hatten, ist es weniger klar, ob sie irgendwelche spezifischen Konzepte oder Anliegen für das hatten, was wir heute als Bewusstsein bezeichnen.
Obwohl die Worte „Bewusstsein“ und „Gewissen“ heute ganz anders verwendet werden, ist es wahrscheinlich, dass die reformatorische Betonung des letzteren als innere Quelle der Wahrheit eine gewisse Rolle bei der nach innen gerichteten Wendung gespielt hat, die so charakteristisch für die moderne reflektierende Sicht des Selbst ist. Der Hamlet, der um 1600 die Bühne betrat, sah seine Welt und sich selbst bereits mit zutiefst modernen Augen.
Zu Beginn der frühen Neuzeit im siebzehnten Jahrhundert war das Bewusstsein in den Mittelpunkt des Denkens über den Geist gerückt. Von der Mitte des 17. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Bewusstsein weithin als wesentlich oder bestimmend für das Mentale angesehen. René Descartes definierte den Begriff des Denkens (pensée) in Form eines reflexiven Bewusstseins oder einer Selbstwahrnehmung. In den „Meditationen über die Grundlagen der Philosophie“ (1640) schrieb er:
Unter dem Wort „Gedanke“ („pensée“) verstehe ich all das, dessen wir uns bewusst sind und das in uns wirkt.
Später, gegen Ende des 17. Jahrhunderts, vertrat John Locke in „An Essay on Human Understanding“ (1688) eine ähnliche, wenn auch etwas differenziertere Auffassung:
Ich sage nicht, dass der Mensch keine Seele hat, weil er sie im Schlaf nicht wahrnimmt. Aber ich sage, dass er zu keiner Zeit, weder im Wachzustand noch im Schlaf, denken kann, ohne sich dessen bewusst zu sein. Unsere Empfindung ist für nichts anderes notwendig als für unsere Gedanken, und für diese ist sie notwendig und wird es immer sein.
Locke verzichtete ausdrücklich darauf, eine Hypothese über die substanzielle Grundlage des Bewusstseins und seine Beziehung zur Materie aufzustellen, aber er betrachtete es eindeutig als wesentlich für das Denken wie auch für die persönliche Identität.
Lockes Zeitgenosse G.W. Leibniz, der sich möglicherweise von seinen mathematischen Arbeiten über Differenzierung und Integration inspirieren ließ, bot in der „Abhandlung über die Metaphysik“ (1686) eine Theorie des Geistes an, die unendlich viele Bewusstseinsstufen und vielleicht sogar einige unbewusste Gedanken, die so genannten „petites perceptions“, zulässt. Leibniz war der erste, der explizit zwischen Wahrnehmung und Apperzeption, d.h. etwa zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein, unterschied. In der „Monadologie“ (1720) brachte er auch seine berühmte Analogie der Mühle vor, um seine Überzeugung auszudrücken, dass Bewusstsein nicht aus bloßer Materie entstehen kann. Er forderte seine Leser auf, sich vorzustellen, dass jemand durch ein erweitertes Gehirn geht, so wie man durch eine Mühle geht und alle mechanischen Vorgänge beobachtet, die für Leibniz die physische Natur des Gehirns erschöpfen. Nirgendwo, so behauptet er, würde ein solcher Beobachter bewusste Gedanken sehen.
Obwohl Leibniz die Möglichkeit des unbewussten Denkens anerkannte, wurden die Bereiche des Denkens und des Bewusstseins in den folgenden zwei Jahrhunderten mehr oder weniger als identisch angesehen. Die assoziative Psychologie, ob sie nun von Locke oder später im 18. Jahrhundert von David Hume (1739) oder im 19. Jahrhundert von James Mill (1829) verfolgt wurde, zielte darauf ab, die Prinzipien zu entdecken, nach denen bewusste Gedanken oder Ideen interagieren oder sich gegenseitig beeinflussen. Der Sohn von James Mill, John Stuart Mill, setzte die Arbeit seines Vaters an der assoziativen Psychologie fort, räumte aber ein, dass Kombinationen von Ideen zu Resultaten führen können, die über ihre geistigen Bestandteile hinausgehen, und lieferte damit ein frühes Modell der geistigen Emergenz (1865).
Der rein assoziative Ansatz wurde im späten 18. Jahrhundert von Immanuel Kant (1787) kritisiert, der argumentierte, dass eine adäquate Erklärung der Erfahrung und des phänomenalen Bewusstseins eine viel reichhaltigere Struktur der mentalen und intentionalen Organisation erfordere. Das phänomenale Bewusstsein konnte nach Kant keine bloße Abfolge von assoziierten Ideen sein, sondern musste zumindest die Erfahrung eines bewussten Selbst sein, das sich in einer objektiven, in Bezug auf Raum, Zeit und Kausalität strukturierten Welt befindet.
In der angloamerikanischen Welt waren assoziative Ansätze bis weit ins 20. Jahrhundert hinein sowohl in der Philosophie als auch in der Psychologie einflussreich, während im deutschen und europäischen Raum ein größeres Interesse an der größeren Struktur der Erfahrung bestand, das zum Teil zur Erforschung der Phänomenologie durch die Arbeiten von Edmund Husserl (1913, 1929), Martin Heidegger (1927), Maurice Merleau-Ponty (1945) und anderen führte, die die Untersuchung des Bewusstseins auf den Bereich des Sozialen, des Körperlichen und des Zwischenmenschlichen ausdehnten.
Zu Beginn der modernen wissenschaftlichen Psychologie in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Geist noch weitgehend mit dem Bewusstsein gleichgesetzt, und introspektive Methoden beherrschten das Feld, wie die Arbeiten von Wilhelm Wundt (1897), Hermann von Helmholtz (1897), William James (1890) und Alfred Titchener (1901) zeigen. Die Beziehung des Bewusstseins zum Gehirn blieb jedoch ein großes Rätsel, wie es in T. H. Huxleys berühmter Bemerkung zum Ausdruck kommt:
Wie etwas so Bemerkenswertes wie ein Bewusstseinszustand durch Reizung des Nervengewebes zustande kommt, ist ebenso unerklärlich wie das Erscheinen des Dschins, als Aladin seine Lampe rieb (1866).
Das frühe 20. Jahrhundert sah den Ausschluß des Bewußtseins aus der wissenschaftlichen Psychologie, vor allem in den Vereinigten Staaten mit dem Aufkommen des Behaviorismus (Watson 1924, Skinner 1953), obwohl Bewegungen wie die Gestaltpsychologie das Bewusstsein in Europa weiterhin als wissenschaftliches Thema behandelten (Köhler 1929, Köffka 1935). In den 1960er Jahren wurde der Einfluss des Behaviorismus mit dem Aufkommen der kognitiven Psychologie und ihrer Betonung der Informationsverarbeitung und der Modellierung interner mentaler Prozesse schwächer (Neisser 1965, Gardiner 1985). Doch trotz der erneuten Betonung der Erklärung kognitiver Fähigkeiten wie Gedächtnis, Wahrnehmung und Sprachverständnis blieb das Bewusstsein noch mehrere Jahrzehnte lang ein weitgehend vernachlässigtes Thema.
In den 1980er und 90er Jahren kam es zu einem großen Aufschwung der wissenschaftlichen und philosophischen Forschung über das Wesen und die Grundlagen des Bewusstseins (Baars 1988, Dennett 1991, Penrose 1989, 1994, Crick 1994, Lycan 1987, 1996, Chalmers 1996). Sobald das Bewusstsein wieder in der Diskussion war, kam es zu einer raschen Verbreitung der Forschung mit einer Flut von Büchern und Artikeln sowie der Einführung von Fachzeitschriften („The Journal of Consciousness Studies“, „Consciousness and Cognition“, „Psyche“), Berufsverbänden („Association for the Scientific Study of Consciousness“, ASSC) und jährlichen Konferenzen, die ausschließlich der Erforschung des Bewusstseins gewidmet waren („The Science of Consciousness“).
2. Konzepte des Bewusstseins
Die Begriffe „Bewusstsein“ und „Bewusstheit“ sind Oberbegriffe, die eine Vielzahl von psychischen Phänomenen abdecken. Beide werden mit einer Vielzahl von Bedeutungen verwendet, und das Adjektiv „bewusst“ ist in seiner Bandbreite heterogen und wird sowohl auf ganze Organismen – das Bewusstsein von Lebewesen – als auch auf bestimmte mentale Zustände und Prozesse – das Zustandsbewusstsein – angewendet (Rosenthal 1986, Gennaro 1995, Carruthers 2000).
2.1 Das Bewusstsein der Kreatur
Ein Tier, eine Person oder ein sonstiges kognitives System kann in verschiedener Hinsicht als bewusst angesehen werden.
Empfindungsvermögen. Es kann bewusst sein im allgemeinen Sinne eines empfindungsfähigen Lebewesens, das in der Lage ist, seine Welt wahrzunehmen und auf sie zu reagieren (Armstrong 1981). Bewusstsein in diesem Sinne kann in verschiedenen Abstufungen vorliegen, und es ist nicht klar definiert, welche Art von sensorischen Fähigkeiten ausreichend sind. Sind Fische in diesem Sinne bewusst? Und was ist mit Krabben oder Bienen?
Wachheit. Darüber hinaus könnte man verlangen, dass der Organismus eine solche Fähigkeit tatsächlich ausübt und nicht nur die Fähigkeit oder Bereitschaft dazu hat. So könnte man ihn nur dann als bewusst betrachten, wenn er wach und normalerweise aufmerksam ist. In diesem Sinne würden Organismen im Schlaf oder in einer der tieferen Stufen des Komas nicht als bewusst gelten. Auch hier können die Grenzen unscharf sein, und es können Zwischenfälle auftreten. Ist man beispielsweise bewusst im relevanten Sinne, wenn man träumt, hypnotisiert ist oder sich in einem Fugue-Zustand befindet?
Selbstbewußtsein. Ein dritter, noch anspruchsvollerer Sinn könnte bewusste Lebewesen als solche definieren, die nicht nur bewusst sind, sondern sich auch bewusst sind, dass sie bewusst sind, und somit das Bewusstsein von Lebewesen als eine Form des Selbstbewusstseins behandeln (Carruthers 2000). Das Erfordernis des Selbstbewusstseins kann auf verschiedene Weise interpretiert werden, und die Lebewesen, die als bewusst im entsprechenden Sinne gelten, variieren entsprechend. Wenn man davon ausgeht, dass es sich um ein explizites konzeptuelles Selbstbewusstsein handelt, könnten viele nicht-menschliche Tiere und sogar kleine Kinder die Voraussetzungen nicht erfüllen, aber wenn nur rudimentärere implizite Formen des Selbstbewusstseins verlangt werden, dann könnte ein breites Spektrum an nicht-sprachlichen Lebewesen als selbstbewusst gelten.
Wie es ist. Thomas Nagels (1974) berühmtes Kriterium „Wie es ist“ zielt darauf ab, eine andere und vielleicht subjektivere Vorstellung davon zu erfassen, ein bewusster Organismus zu sein. Nagel zufolge ist ein Lebewesen nur dann bewusst, wenn es „etwas gibt, wie es ist“, dieses Lebewesen zu sein, d. h. eine subjektive Art und Weise, wie die Welt aus der geistigen oder erfahrungsmäßigen Sicht des Lebewesens erscheint. In Nagels Beispiel sind Fledermäuse bewusst, weil es etwas gibt, das für eine Fledermaus so ist, wie sie ihre Welt durch ihre echolokatorischen Sinne erfährt, auch wenn wir Menschen von unserem menschlichen Standpunkt aus nicht nachdrücklich verstehen können, wie ein solcher Bewusstseinsmodus aus der Sicht der Fledermaus selbst aussieht.
Gegenstand von Bewusstseinszuständen. Eine fünfte Alternative bestünde darin, den Begriff des bewussten Organismus im Sinne von bewussten Zuständen zu definieren. Das heißt, man könnte zunächst definieren, was einen mentalen Zustand zu einem bewussten mentalen Zustand macht, und dann definieren, dass man ein bewusstes Lebewesen ist, wenn man solche Zustände hat. Das Konzept eines bewussten Organismus würde dann davon abhängen, was man unter bewussten Zuständen versteht (Abschnitt 2.2).
Transitives Bewußtsein. Neben der Beschreibung von Lebewesen als bewusst in diesen verschiedenen Bedeutungen, gibt es auch verwandte Bedeutungen, in denen Lebewesen als bewusst gegenüber verschiedenen Dingen beschrieben werden. Die Unterscheidung wird manchmal als die zwischen transitivem und intransitivem Begriff des Bewusstseins bezeichnet, wobei ersterer ein Objekt beinhaltet, auf das das Bewusstsein gerichtet ist (Rosenthal 1986).
2.2 Zustandsbewusstsein
Der Begriff „bewusster geistiger Zustand“ hat ebenfalls eine Vielzahl von unterschiedlichen, wenn auch vielleicht miteinander verbundenen Bedeutungen. Es gibt mindestens sechs Hauptoptionen.
Zustände, derer man sich bewusst ist. Nach einer gängigen Lesart ist ein bewusster mentaler Zustand einfach ein mentaler Zustand, dessen man sich bewusst ist (Rosenthal 1986, 1996). Bewusste Zustände in diesem Sinne beinhalten eine Form von Meta-Mentalität oder Meta-Intentionalität, insofern sie mentale Zustände voraussetzen, die sich selbst auf mentale Zustände beziehen. Einen bewussten Wunsch nach einer Tasse Kaffee zu haben, bedeutet, einen solchen Wunsch zu haben und sich gleichzeitig und unmittelbar bewusst zu sein, dass man einen solchen Wunsch hat. Unbewusste Gedanken und Wünsche in diesem Sinne sind einfach diejenigen, die wir haben, ohne uns ihrer bewusst zu sein, unabhängig davon, ob unser Mangel an Selbsterkenntnis aus einfacher Unaufmerksamkeit oder aus tieferen psychoanalytischen Gründen resultiert.
Qualitative Zustände. Zustände können auch in einem scheinbar ganz anderen, eher qualitativen Sinne als bewusst angesehen werden. Das heißt, man könnte einen Zustand nur dann als bewusst bezeichnen, wenn er qualitative oder erfahrungsbezogene Eigenschaften der Art hat oder beinhaltet, die oft als „Qualia“ oder „rohe Sinneseindrücke“ bezeichnet werden (siehe den Eintrag über Qualia). Die Wahrnehmung des Merlot, den man trinkt, oder des Stoffes, den man untersucht, gilt als bewusster mentaler Zustand in diesem Sinne, weil sie verschiedene sensorische Qualia beinhaltet, z. B. Geschmacksqualia im Fall des Weins und Farbqualia in der visuellen Erfahrung des Stoffes. Über die Natur solcher Qualia (Churchland 1985, Shoemaker 1990, Clark 1993, Chalmers 1996) und sogar über ihre Existenz herrscht erhebliche Uneinigkeit. Traditionell wurden Qualia als intrinsische, private, unaussprechliche monadische Merkmale der Erfahrung betrachtet, aber aktuelle Theorien über Qualia lehnen zumindest einige dieser Verpflichtungen ab (Dennett 1990).
Phänomenale Zustände. Solche Qualia werden manchmal als phänomenale Eigenschaften und die damit verbundene Art des Bewusstseins als phänomenales Bewusstsein bezeichnet, aber der letztere Begriff wird vielleicht eher auf die Gesamtstruktur der Erfahrung angewandt und umfasst weit mehr als sensorische Qualia. Die phänomenale Struktur des Bewusstseins umfasst auch einen Großteil der räumlichen, zeitlichen und begrifflichen Organisation unserer Erfahrung der Welt und von uns selbst als Akteure in ihr (siehe Abschnitt 4.3). Daher ist es wahrscheinlich am besten, zumindest anfänglich, das Konzept des phänomenalen Bewusstseins von dem des qualitativen Bewusstseins zu unterscheiden, auch wenn es zweifellos Überschneidungen gibt.
„Was es ist“-ähnliche Zustände. Bewusstsein in diesen beiden Bedeutungen knüpft auch an Thomas Nagels (1974) Begriff eines bewussten Wesens an, insofern als man einen mentalen Zustand als bewusst im Sinne von „wie es ist“ betrachten kann, wenn es etwas gibt, das so ist, wie es ist, in diesem Zustand zu sein. Nagels Kriterium könnte so verstanden werden, dass es darauf abzielt, eine Ich- oder Innenvorstellung davon zu liefern, was einen Zustand zu einem phänomenalen oder qualitativen Zustand macht.
Zugangsbewusstsein. Zustände können in einem scheinbar ganz anderen Sinne bewusst sein, der mehr mit intra-mentalen Beziehungen zu tun hat. In dieser Hinsicht ist das Bewusstsein eines Zustands eine Frage seiner Verfügbarkeit für die Interaktion mit anderen Zuständen und des Zugangs, den man zu seinem Inhalt hat. In diesem eher funktionalen Sinne, der dem entspricht, was Ned Block (1995) Zugangsbewusstsein nennt, ist das Bewusstsein eines visuellen Zustands nicht so sehr eine Frage dessen, ob er eine qualitative „Ähnlichkeit“ hat oder nicht, sondern ob er und die visuellen Informationen, die er trägt, allgemein für die Nutzung und Führung durch den Organismus verfügbar sind oder nicht. In dem Maße, in dem die Informationen in diesem Zustand für den Organismus, der ihn enthält, reichhaltig und flexibel verfügbar sind, zählt er als bewusster Zustand in der relevanten Hinsicht, unabhängig davon, ob er ein qualitatives oder phänomenales Gefühl im Sinne Nagels hat oder nicht.
Narratives Bewusstsein. Zustände könnten auch in einem narrativen Sinne als bewusst angesehen werden, der sich auf den Begriff des „Bewusstseinsstroms“ beruft, der als eine fortlaufende, mehr oder weniger serielle Erzählung von Episoden aus der Perspektive eines tatsächlichen oder nur virtuellen Selbst betrachtet wird. Die Idee wäre, die bewussten mentalen Zustände der Person mit denen gleichzusetzen, die im Strom erscheinen (Dennett 1991, 1992).
Obwohl diese sechs Begriffe für das, was einen Zustand zu einem bewussten Zustand macht, unabhängig voneinander spezifiziert werden können, sind sie natürlich nicht ohne potenzielle Verbindungen, und sie erschöpfen auch nicht den Bereich der möglichen Optionen. Wenn man Verbindungen herstellt, könnte man argumentieren, dass Zustände nur insofern im Bewusstseinsstrom erscheinen, als wir uns ihrer bewusst sind, und so eine Verbindung zwischen dem ersten meta-mentalen Begriff eines bewussten Zustands und dem Strom- oder Erzählkonzept herstellen. Oder man könnte den Zugang mit den qualitativen oder phänomenalen Begriffen eines Bewusstseinszustandes verbinden, indem man zu zeigen versucht, dass Zustände, die auf diese Weise repräsentieren, ihre Inhalte in der vom Zugangsbegriff geforderten Weise weithin verfügbar machen.
Um über die sechs Optionen hinauszugehen, könnte man bewusste von unbewussten Zuständen unterscheiden, indem man sich auf andere Aspekte ihrer intra-mentalen Dynamik und Interaktionen als bloße Zugriffsbeziehungen beruft; z.B. könnten bewusste Zustände einen reicheren Bestand an inhaltssensiblen Interaktionen oder ein größeres Maß an flexibler zielgerichteter Steuerung aufweisen, wie sie mit der selbstbewussten Kontrolle des Denkens verbunden ist. Alternativ könnte man versuchen, Bewusstseinszustände im Sinne von bewussten Lebewesen zu definieren. Das heißt, man könnte darlegen, was es bedeutet, ein bewusstes Wesen oder vielleicht sogar ein bewusstes Selbst zu sein, und dann seine Vorstellung von einem bewussten Zustand als Zustand eines solchen Wesens oder Systems definieren, was die Umkehrung der letzten, oben erwogenen Option wäre, bewusste Wesen durch bewusste mentale Zustände zu definieren.
2.3 Das Bewusstsein als Entität
Das Substantiv „Bewusstsein“ hat eine ebenso große Bandbreite an Bedeutungen, die weitgehend mit denen des Adjektivs „bewusst“ übereinstimmen. Man kann zwischen Geschöpf- und Zustandsbewusstsein sowie zwischen den Varianten beider unterscheiden. Man kann sich speziell auf das phänomenale Bewusstsein, das Zugriffsbewusstsein, das reflexive oder meta-mentale Bewusstsein und das narrative Bewusstsein beziehen, neben anderen Varianten.
Dabei wird das Bewusstsein selbst in der Regel nicht als substanzielle Entität behandelt, sondern lediglich als abstrakte Verdinglichung der Eigenschaft oder des Aspekts, die bzw. der durch die entsprechende Verwendung des Adjektivs „bewusst“ zugeschrieben wird. Zugriffsbewusstsein ist lediglich die Eigenschaft, die erforderliche Art von internen Zugriffsbeziehungen zu haben, und qualitatives Bewusstsein ist einfach die Eigenschaft, die zugeschrieben wird, wenn „bewusst“ im qualitativen Sinne auf mentale Zustände angewendet wird. Inwieweit man sich damit auf den ontologischen Status des Bewusstseins an sich festlegt, hängt davon ab, wie sehr man ein Platonist in Bezug auf Universalien im Allgemeinen ist (siehe den Eintrag über das mittelalterliche Problem der Universalien). Es muss einen nicht auf das Bewusstsein als eine eigenständige Entität festlegen, genauso wenig wie die Verwendung von „quadratisch“, „rot“ oder „sanft“ auf die Existenz von „quadratisch“, „rot“ oder „sanft“ als eigenständige Entitäten festlegen muss.
Auch wenn dies nicht die Norm ist, könnte man dennoch eine realistischere Sichtweise des Bewusstseins als Bestandteil der Realität einnehmen. Das heißt, man könnte das Bewusstsein eher mit elektromagnetischen Feldern als mit dem Leben gleichsetzen.
Seit dem Niedergang des Vitalismus betrachten wir das Leben nicht mehr als etwas, das sich per se von den lebenden Dingen unterscheidet. Es gibt lebende Dinge, einschließlich Organismen, Zustände, Eigenschaften und Teile von Organismen, Gemeinschaften und evolutionäre Abstammungslinien von Organismen, aber das Leben selbst ist keine weitere Sache, keine zusätzliche Komponente der Realität, keine vitale Kraft, die den lebenden Dingen hinzugefügt wird. Wir wenden das Adjektiv „lebendig“ korrekt auf viele Dinge an, und man könnte sagen, dass wir ihnen damit Leben zuschreiben, aber ohne eine andere Bedeutung oder Realität als die, die damit verbunden ist, dass sie lebende Dinge sind.
Elektromagnetische Felder werden dagegen als reale und unabhängige Teile unserer physikalischen Welt betrachtet. Auch wenn man manchmal in der Lage ist, die Werte eines solchen Feldes zu spezifizieren, indem man sich auf das Verhalten von Teilchen in diesem Feld beruft, werden die Felder selbst als konkrete Bestandteile der Realität betrachtet und nicht nur als Abstraktionen oder als Mengen von Beziehungen zwischen Teilchen.
In ähnlicher Weise könnte man „Bewusstsein“ als eine Komponente oder einen Aspekt der Realität betrachten, der sich in bewussten Zuständen und Lebewesen manifestiert, aber mehr ist als nur die abstrakte Nominalisierung des Adjektivs „bewusst“, das wir auf sie anwenden. Obwohl solche stark realistischen Ansichten derzeit nicht sehr verbreitet sind, sollten sie in den logischen Raum der Möglichkeiten aufgenommen werden.
Es gibt also viele Konzepte des Bewusstseins, und sowohl „bewusst“ als auch „Bewusstsein“ werden auf unterschiedlichste Weise verwendet, ohne dass es eine privilegierte oder kanonische Bedeutung gibt. Dies ist jedoch weniger eine Peinlichkeit als vielmehr eine Verlegenheit des Reichtums. Das Bewusstsein ist ein komplexes Merkmal der Welt, und um es zu verstehen, bedarf es einer Vielfalt von begrifflichen Instrumenten, um seine vielen unterschiedlichen Aspekte zu erfassen. Begriffliche Pluralität ist also genau das, was man sich erhoffen würde. Solange man Verwirrung vermeidet, indem man sich über seine Bedeutungen im Klaren ist, ist es von großem Wert, über eine Vielzahl von Konzepten zu verfügen, mit denen wir das Bewusstsein in seiner ganzen reichen Komplexität erfassen können. Man sollte jedoch nicht davon ausgehen, dass begriffliche Pluralität eine referenzielle Divergenz impliziert. Unsere vielfältigen Konzepte des Bewusstseins können in der Tat unterschiedliche Aspekte eines einzigen, einheitlichen, zugrunde liegenden mentalen Phänomens herausgreifen. Ob und in welchem Ausmaß sie dies tun, bleibt eine offene Frage.
3. Probleme des Bewusstseins
Die Aufgabe, das Bewusstsein zu verstehen, ist ein ebenso vielfältiges Projekt. Es gibt nicht nur viele verschiedene Aspekte des Geistes, die in gewisser Weise als bewusst gelten, sondern es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, sie zu erklären oder zu modellieren. Zum Verständnis des Bewusstseins gehört nicht nur eine Vielzahl von Erklärungen, sondern auch von Fragen, die sie aufwerfen, und die Art von Antworten, die sie erfordern. Auf die Gefahr hin, zu sehr zu vereinfachen, lassen sich die relevanten Fragen unter drei groben Rubriken zusammenfassen: die Was-, Wie- und Warum-Fragen:
- Die beschreibende Frage: Was ist Bewusstsein? Was sind seine Hauptmerkmale? Und mit welchen Mitteln können sie am besten entdeckt, beschrieben und modelliert werden?
- Die erklärende Frage: Wie kommt das Bewusstsein der relevanten Art zustande? Ist es ein primitiver Aspekt der Realität, und wenn nicht, wie entsteht oder könnte Bewusstsein in der relevanten Hinsicht aus unbewussten Entitäten oder Prozessen entstehen oder durch diese verursacht werden?
- Die funktionale Frage: Warum existiert das Bewusstsein in der betreffenden Art? Hat es eine Funktion, und wenn ja, wie lautet sie? Wirkt es kausal und wenn ja, mit welcher Art von Auswirkungen? Hat es einen Einfluss auf die Funktionsweise von Systemen, in denen es vorhanden ist, und wenn ja, warum und wie?
Die drei Fragen konzentrieren sich jeweils auf die Beschreibung der Merkmale des Bewusstseins, die Erklärung seiner zugrunde liegenden Basis oder Ursache und die Erläuterung seiner Rolle oder seines Wertes. Die Unterteilung in die drei Bereiche ist natürlich etwas künstlich, und in der Praxis werden die Antworten, die man auf die einzelnen Fragen gibt, zum Teil davon abhängen, was man über die anderen Fragen sagt. Man kann beispielsweise die Frage nach dem „Was“ nicht angemessen beantworten und die wichtigsten Merkmale des Bewusstseins beschreiben, ohne auf die Frage nach dem „Warum“ einzugehen, d. h. auf die funktionale Rolle des Bewusstseins innerhalb der Systeme, deren Abläufe es beeinflusst. Man könnte auch nicht erklären, wie die relevante Art von Bewusstsein aus unbewussten Prozessen entstehen könnte, wenn man nicht genau wüsste, welche Merkmale verursacht oder realisiert werden müssen, um als Ursache für das Bewusstsein zu gelten. Ungeachtet dieser Vorbehalte bietet die Dreiteilung der Fragen eine nützliche Struktur, um das gesamte Erklärungsprojekt zu formulieren und die Angemessenheit bestimmter Theorien oder Modelle des Bewusstseins zu bewerten.
4. Die beschreibende Frage: Was sind die Merkmale des Bewusstseins?
Die Was-Frage fordert uns auf, die Hauptmerkmale des Bewusstseins zu beschreiben und zu modellieren, aber welche Merkmale relevant sind, hängt von der Art des Bewusstseins ab, das wir erfassen wollen. Die Haupteigenschaften des Zugriffsbewusstseins können ganz anders sein als die des qualitativen oder phänomenalen Bewusstseins, und die des reflexiven oder narrativen Bewusstseins können sich von beiden unterscheiden. Wenn wir jedoch detaillierte Theorien für jeden Typus aufstellen, können wir hoffen, wichtige Verbindungen zwischen ihnen zu finden und vielleicht sogar zu entdecken, dass sie zumindest in einigen Schlüsselaspekten übereinstimmen.
4.1 Daten in der ersten und dritten Person
Das allgemeine Beschreibungsprojekt wird eine Vielzahl von Untersuchungsmethoden erfordern (Flanagan 1992). Obwohl man die Tatsachen des Bewusstseins naiverweise als zu selbstverständlich ansehen könnte, um irgendwelche systematischen Methoden der Datenerfassung zu benötigen, ist die epistemische Aufgabe in Wirklichkeit alles andere als trivial (Husserl 1913).
Der introspektive Zugang zur ersten Person bietet eine reichhaltige und wesentliche Quelle für Einblicke in unser bewusstes Geistesleben, aber er ist weder ausreichend noch besonders hilfreich, wenn er nicht auf geschulte und disziplinierte Weise genutzt wird. Um die notwendigen Erkenntnisse über die Struktur der Erfahrung zu gewinnen, müssen wir sowohl phänomenologisch versierte Selbstbeobachter werden als auch unsere introspektiven Ergebnisse durch viele Arten von Daten aus der dritten Person ergänzen, die externen Beobachtern zur Verfügung stehen (Searle 1992, Varela 1995, Siewert 1998).
Wie Phänomenologen seit mehr als einem Jahrhundert wissen, erfordert die Entdeckung der Struktur bewusster Erfahrung eine rigorose, nach innen gerichtete Haltung, die sich von unserer alltäglichen Form der Selbstwahrnehmung deutlich unterscheidet (Husserl 1929, Merleau-Ponty 1945). Eine qualifizierte Beobachtung der erforderlichen Art erfordert Training, Anstrengung und die Fähigkeit, alternative Perspektiven auf die eigene Erfahrung einzunehmen.
Der Bedarf an empirischen Daten aus der dritten Person, die von externen Beobachtern gesammelt werden, ist vielleicht am offensichtlichsten im Hinblick auf die eindeutig funktionalen Bewusstseinsarten wie das Zugangsbewusstsein, aber er ist auch im Hinblick auf das phänomenale und qualitative Bewusstsein erforderlich. So können uns beispielsweise Defizitstudien, die verschiedene neuronale und funktionelle Schädigungen mit Anomalien des bewussten Erlebens korrelieren, Aspekte der phänomenalen Struktur bewusst machen, die unserem normalen introspektiven Bewusstsein entgehen. Wie solche Fallstudien zeigen, können Dinge in der Erfahrung auseinanderfallen, die aus unserer normalen Ich-Perspektive untrennbar vereint oder einzigartig erscheinen (Sacks 1985, Shallice 1988, Farah 1995).
Oder, um ein anderes Beispiel zu nennen, Daten aus der dritten Person können uns bewusst machen, wie sich unsere Erfahrungen mit dem Handeln und unsere Erfahrungen mit dem Timing von Ereignissen in einer Weise gegenseitig beeinflussen, die wir durch bloße Introspektion niemals erkennen könnten (Libet 1985, Wegner 2002). Die Fakten, die mit diesen Methoden der dritten Person gesammelt werden, betreffen nicht nur die Ursachen oder Grundlagen des Bewusstseins, sondern oft auch die Struktur des phänomenalen Bewusstseins selbst. Interaktive Methoden der ersten, dritten und vielleicht sogar zweiten Person (Varela 1995) werden alle benötigt, um die erforderlichen Beweise zu sammeln.
Mit Hilfe all dieser Datenquellen werden wir hoffentlich in der Lage sein, detaillierte Beschreibungsmodelle der verschiedenen Arten von Bewusstsein zu erstellen. Auch wenn die spezifischen Merkmale, die am wichtigsten sind, je nach Art des Bewusstseins variieren können, wird unser beschreibendes Gesamtprojekt mindestens die folgenden sieben allgemeinen Aspekte des Bewusstseins berücksichtigen müssen (Abschnitte 4.2-4.7).
4.2 Qualitativer Charakter
Qualitativer Charakter wird oft mit den so genannten „rohen Gefühlen“ gleichgesetzt und durch die Rötung, die man beim Anblick reifer Tomaten empfindet, oder den spezifischen süßen Geschmack, den man beim Probieren einer ebenso reifen Ananas erfährt, veranschaulicht (Locke 1688). Die relevante Art des qualitativen Charakters ist nicht auf sensorische Zustände beschränkt, sondern wird typischerweise als ein Aspekt von Erfahrungszuständen im Allgemeinen betrachtet, wie z. B. erlebte Gedanken oder Wünsche (Siewert 1998).
Das Vorhandensein solcher Empfindungen mag für manche die Schwelle für Zustände oder Lebewesen markieren, die wirklich bewusst sind. Wenn ein Organismus seine Welt auf geeignete Weise wahrnimmt und auf sie reagiert, ihm aber solche Qualia fehlen, dann könnte er bestenfalls in einem lockeren und weniger wörtlichen Sinne als bewusst gelten. Zumindest scheint es so für diejenigen, die qualitatives Bewusstsein im Sinne von „wie es ist“ als philosophisch und wissenschaftlich zentral ansehen (Nagel 1974, Chalmers 1996).
Qualia-Probleme in vielen Formen – Kann es umgekehrte Qualia geben? (Block 1980a 1980b, Shoemaker 1981, 1982) Sind Qualia epiphänomenal? (Jackson 1982, Chalmers 1996) Wie können neuronale Zustände zu Qualia führen? (Levine 1983, McGinn 1991) – haben in der jüngeren Vergangenheit große Bedeutung erlangt. Aber die Was-Frage wirft ein grundlegenderes Problem der Qualia auf: nämlich das, eine klare und artikulierte Beschreibung unseres Qualia-Raums und des Status spezifischer Qualia innerhalb dieses Raums zu geben.
In Ermangelung eines solchen Modells sind faktische oder beschreibende Fehler nur allzu wahrscheinlich. So wird z. B. bei Behauptungen über die Unverständlichkeit der Verbindung zwischen erlebtem Rot und einem möglichen neuronalen Substrat einer solchen Erfahrung die relevante Farbquale manchmal als eine einfache und sui generis-Eigenschaft behandelt (Levine 1983), aber phänomenale Röte existiert tatsächlich in einem komplexen Farbraum mit mehreren systematischen Dimensionen und Ähnlichkeitsbeziehungen (Hardin 1992). Das Verständnis der spezifischen Farbquale im Verhältnis zu dieser größeren relationalen Struktur gibt uns nicht nur ein besseres beschreibendes Verständnis ihrer qualitativen Natur, sondern kann auch einige „Aufhänger“ liefern, an denen man verständliche psychophysische Verbindungen festmachen kann.
Farbe mag eine Ausnahme sein, wenn es darum geht, dass wir ein spezifisches und gut entwickeltes formales Verständnis des relevanten qualitativen Raums haben, aber sie ist wahrscheinlich keine Ausnahme, wenn es um die Bedeutung solcher Räume für unser Verständnis von qualitativen Eigenschaften im Allgemeinen geht (Clark 1993, P.M. Churchland 1995). (Siehe den Eintrag über Qualia.)
4.3 Phänomenale Struktur
Die phänomenale Struktur sollte nicht mit der qualitativen Struktur verwechselt werden, auch wenn die Begriffe „Qualia“ und „phänomenale Eigenschaften“ in der Literatur manchmal synonym verwendet werden. Die „phänomenale Organisation“ umfasst alle verschiedenen Arten von Ordnung und Struktur im Bereich der Erfahrung, d. h. im Bereich der Welt, wie sie uns erscheint. Es gibt offensichtlich wichtige Verbindungen zwischen dem Phänomenalen und dem Qualitativen. In der Tat lassen sich Qualia am besten als Eigenschaften phänomenaler oder erfahrener Objekte verstehen, aber das Phänomenale umfasst weit mehr als bloße Empfindungen. Wie Kant (1787), Husserl (1913) und Generationen von Phänomenologen gezeigt haben, ist die phänomenale Struktur der Erfahrung reichhaltig intentional und umfasst nicht nur sensorische Ideen und Qualitäten, sondern auch komplexe Repräsentationen von Zeit, Raum, Ursache, Körper, Selbst, Welt und der organisierten Struktur der gelebten Realität in all ihren begrifflichen und nicht-begrifflichen Formen.
Da viele unbewusste Zustände auch intentionale und repräsentationale Aspekte haben, ist es vielleicht am besten, die phänomenale Struktur als eine besondere Art von intentionaler und repräsentationaler Organisation und Inhalt zu betrachten, die Art, die eindeutig mit dem Bewusstsein verbunden ist (Siewert 1998). (Siehe den Eintrag über Repräsentationstheorien des Bewusstseins.)
Die Beantwortung der Was-Frage erfordert eine sorgfältige Darstellung des kohärenten und dicht organisierten Repräsentationsrahmens, in den bestimmte Erfahrungen eingebettet sind. Da der größte Teil dieser Struktur nur implizit in der Organisation der Erfahrung enthalten ist, kann sie nicht einfach durch Introspektion abgelesen werden. Die Struktur des phänomenalen Bereichs klar und verständlich zu formulieren, ist ein langer und schwieriger Prozess der Inferenz und Modellbildung (Husserl 1929). Introspektion kann dabei helfen, aber es ist auch eine Menge Theoriebildung und Einfallsreichtum erforderlich.
In jüngster Zeit hat es eine philosophische Debatte über das Spektrum der Eigenschaften gegeben, die in der bewussten Erfahrung phänomenal präsent oder manifest sind, insbesondere in Bezug auf kognitive Zustände wie Glauben oder Denken. Einige haben sich für eine so genannte „dünne“ Sichtweise ausgesprochen, nach der phänomenale Eigenschaften auf Qualia beschränkt sind, die grundlegende sensorische Eigenschaften wie Farben, Formen, Töne und Gefühle repräsentieren. Solchen Theoretikern zufolge gibt es keine ausgeprägte „Was-es-ist-Gleichheit“, wenn man glaubt, dass Paris die Hauptstadt von Frankreich ist oder dass 17 eine Primzahl ist (Tye, Prinz 2012). Ein paar Bilder, z. B. vom Eiffelturm, können uns bei einem solchen Gedanken begleiten, aber das ist nebensächlich, und der kognitive Zustand selbst hat keine phänomenale Bedeutung. Nach der „dünnen“ Auffassung ist der phänomenale Aspekt von Wahrnehmungszuständen ebenfalls auf grundlegende sensorische Merkmale beschränkt; wenn man ein Bild von Winston Churchill sieht, beschränkt sich die phänomenale Wahrnehmung nur auf die räumlichen Aspekte seines Gesichts.
Andere vertreten eine „dicke“ Sichtweise, nach der die Phänomenologie der Wahrnehmung ein viel breiteres Spektrum von Merkmalen umfasst und auch kognitive Zustände eine ausgeprägte Phänomenologie haben (Strawson 2003, Pitt 2004, Seigel 2010). Nach der „dicken“ Sichtweise schließt die Ähnlichkeit der Wahrnehmung eines Bildes von Marilyn Monroe mit dem, was es ist, die Anerkennung ihrer Geschichte als Teil des gefühlten Aspekts der Erfahrung ein, und auch Überzeugungen und Gedanken können und haben typischerweise eine ausgeprägte nicht-sensorische Phänomenologie. Beide Seiten der Debatte sind in dem Band „Cognitive Phenomenology“ (Bayne und Montague 2010) gut vertreten.
4.4 Subjektivität
Subjektivität ist ein weiterer Begriff, der in der Literatur manchmal mit den qualitativen oder phänomenalen Aspekten des Bewusstseins gleichgesetzt wird, aber auch hier gibt es gute Gründe, sie zumindest in einigen ihrer Formen als ein eigenständiges Merkmal des Bewusstseins anzuerkennen, das mit den qualitativen und phänomenalen Aspekten zusammenhängt, sich aber von ihnen unterscheidet. Die epistemische Form der Subjektivität betrifft insbesondere die offensichtlichen Grenzen der Wissbarkeit oder sogar der Verstehbarkeit verschiedener Fakten über bewusste Erfahrung (Nagel 1974, Van Gulick 1985, Lycan 1996).
Nach Thomas Nagel (1974) sind Fakten darüber, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, im relevanten Sinne subjektiv, weil sie nur vom Standpunkt der Fledermaus aus vollständig verstanden werden können. Nur Lebewesen, die in der Lage sind, ähnliche Erfahrungen zu machen, können ihre Ähnlichkeit im erforderlichen empathischen Sinne verstehen. Fakten über bewusstes Erleben können aus der Sicht eines außenstehenden Dritten, wie sie mit der objektiven Naturwissenschaft assoziiert wird, bestenfalls unvollständig verstanden werden. Eine ähnliche Ansicht über die Grenzen der Theorie der dritten Person scheint hinter den Behauptungen darüber zu stehen, was Frank Jacksons (1982) hypothetische Mary, die Super-Farbwissenschaftlerin, aufgrund ihrer eigenen verarmten Geschichte achromatischer visueller Erfahrung nicht über die Erfahrung von Rot verstehen könnte.
Ob Tatsachen über Erfahrung tatsächlich auf diese Weise epistemisch begrenzt sind, ist umstritten (Lycan 1996), aber die Behauptung, dass das Verständnis des Bewusstseins besondere Formen des Wissens und des Zugangs aus der Innenperspektive erfordert, ist intuitiv plausibel und hat eine lange Geschichte (Locke 1688). Daher muss jede angemessene Antwort auf die Was-Frage den epistemischen Status des Bewusstseins ansprechen, sowohl unsere Fähigkeiten, es zu verstehen, als auch deren Grenzen (Papineau 2002, Chalmers 2003). (Siehe den Eintrag über Selbsterkenntnis.)
4.5 Organisation der Selbstbeobachtung
Die perspektivische Struktur des Bewusstseins ist ein Aspekt seiner allgemeinen phänomenalen Organisation, aber sie ist wichtig genug, um eine eigenständige Diskussion zu verdienen. Insofern die Schlüsselperspektive die des bewussten Selbst ist, könnte man das spezifische Merkmal als Selbstperspektivität bezeichnen. Bewusste Erfahrungen existieren nicht als isolierte mentale Atome, sondern als Modi oder Zustände eines bewussten Selbst oder Subjekts (Descartes 1644, Searle 1992, obwohl Hume 1739). Die visuelle Erfahrung einer blauen Kugel setzt immer voraus, dass es ein Selbst oder ein Subjekt gibt, das auf diese Weise wahrgenommen wird. Ein scharfer und stechender Schmerz ist immer ein Schmerz, der von einem bewussten Subjekt empfunden oder erlebt wird. Das Selbst muss nicht als explizites Element in unseren Erfahrungen erscheinen, aber wie Kant (1787) feststellte, muss das „Ich denke“ zumindest potenziell jede dieser Erfahrungen begleiten.
Das Selbst kann als der perspektivische Punkt betrachtet werden, von dem aus die Welt der Objekte erfahrbar ist (Wittgenstein 1921). Es bietet nicht nur eine räumliche und zeitliche Perspektive für unsere Erfahrung der Welt, sondern auch eine der Bedeutung und Verständlichkeit. Die intentionale Kohärenz des Erfahrungsbereichs beruht auf der doppelten Interdependenz zwischen dem Selbst und der Welt: dem Selbst als Perspektive, von der aus Objekte erkannt werden, und der Welt als integrierter Struktur von Objekten und Ereignissen, deren Erfahrungsmöglichkeiten implizit die Natur und den Ort des Selbst bestimmen (Kant 1787, Husserl 1929).
Bewusste Organismen unterscheiden sich offensichtlich in dem Ausmaß, in dem sie ein einheitliches und kohärentes Selbst konstituieren, und sie unterscheiden sich wahrscheinlich dementsprechend in der Art oder dem Grad der perspektivischen Ausrichtung, die sie in ihren jeweiligen Formen der Erfahrung verkörpern (Lorenz 1977). Bewusstsein erfordert vielleicht kein ausgeprägtes oder substantielles Selbst im traditionellen kartesianischen Sinne, aber zumindest ein gewisses Maß an perspektivisch selbstähnlicher Organisation scheint für die Existenz von allem, was als bewusste Erfahrung gelten könnte, unerlässlich zu sein. Erfahrungen scheinen ohne ein Selbst oder ein Subjekt, das sie erlebt, genauso wenig existieren zu können wie Meereswellen ohne das Meer, durch das sie sich bewegen. Die deskriptive Frage erfordert daher eine Erklärung des selbstperspektivischen Aspekts der Erfahrung und der selbstähnlichen Organisation des Bewusstseins, von der sie abhängt, selbst wenn die entsprechende Erklärung das Selbst auf relativ deflationäre und virtuelle Weise behandelt (Dennett 1991, 1992).
4.6 Einheit
Die Einheit ist eng mit der Selbstperspektive verknüpft, verdient aber als Schlüsselaspekt der Organisation des Bewusstseins eine eigene Erwähnung. Sowohl bewusste Systeme als auch bewusste mentale Zustände beinhalten viele verschiedene Formen von Einheit. Bei einigen handelt es sich um kausale Einheiten, die mit der Integration von Handlung und Kontrolle zu einem einheitlichen Handlungsschwerpunkt verbunden sind. Bei anderen handelt es sich um eher repräsentative und intentionale Formen der Einheit, die die Integration verschiedener Inhalte auf vielen Skalen und Bindungsebenen beinhalten (Cleeremans 2003).
Einige dieser Integrationen sind relativ lokal, wie z.B. wenn verschiedene Merkmale, die innerhalb einer einzigen Sinnesmodalität erkannt werden, zu einer Repräsentation externer Objekte mit diesen Merkmalen kombiniert werden, z.B. wenn man eine bewusste visuelle Erfahrung einer sich bewegenden roten Suppendose macht, die über eine grün gestreifte Serviette rollt (Triesman und Gelade 1980).
Andere Formen der intentionalen Einheit umfassen ein weitaus größeres Spektrum an Inhalten. Der Inhalt der gegenwärtigen Erfahrung des Raumes, in dem man sitzt, hängt zum Teil von seiner Verortung innerhalb einer viel größeren Struktur ab, die mit dem Bewusstsein der eigenen Existenz als fortlaufender, zeitlich ausgedehnter Beobachter in einer Welt räumlich verbundener, unabhängig existierender Objekte verbunden ist (Kant 1787, Husserl 1913). Die individuelle Erfahrung kann nur deshalb den Inhalt haben, den sie hat, weil sie sich innerhalb dieser größeren, einheitlichen Struktur der Repräsentation befindet. (Siehe den Eintrag über die Einheit des Bewusstseins.)
Besondere Aufmerksamkeit wurde in letzter Zeit dem Begriff der phänomenalen Einheit (Bayne 2010) und seiner Beziehung zu anderen Formen der bewussten Einheit gewidmet, wie z. B. der repräsentativen, funktionalen oder neuronalen Integration. Einige haben argumentiert, dass phänomenale Einheit auf repräsentationale Einheit reduziert werden kann (Tye 2005), während andere die Möglichkeit einer solchen Reduktion bestritten haben (Bayne 2010).
4.7 Intentionalität und Transparenz
Bewusste mentale Zustände werden typischerweise als repräsentativ oder intentional angesehen, insofern sie sich auf Dinge beziehen, auf Dinge verweisen oder Befriedigungsbedingungen haben. Die bewusste visuelle Erfahrung stellt die Welt korrekt dar, wenn auf dem Tisch Flieder in einer weißen Vase steht (pace Travis 2004), die bewusste Erinnerung an den Anschlag auf das World Trade Center und der bewusste Wunsch nach einem Glas kaltem Wasser. Aber auch unbewusste Zustände können auf diese Weise Intentionalität zeigen, und es ist wichtig zu verstehen, inwiefern die Darstellungsaspekte bewusster Zustände denen unbewusster Zustände ähneln und sich von ihnen unterscheiden (Carruthers 2000). Searle (1990) vertritt die gegenteilige Ansicht, wonach nur bewusste Zustände und Dispositionen zu bewussten Zuständen wirklich intentional sein können, aber die meisten Theoretiker betrachten Intentionalität als weit in den unbewussten Bereich hineinreichend. (Siehe den Eintrag über Bewusstsein und Intentionalität.)
Eine potenziell wichtige Dimension des Unterschieds betrifft die so genannte Transparenz, die ein wichtiges Merkmal des Bewusstseins in zwei miteinander verknüpften metaphorischen Bedeutungen ist, von denen jede einen intentionalen, einen erfahrungsbezogenen und einen funktionalen Aspekt hat.
Bewusste Wahrnehmungserfahrungen werden oft als transparent oder, wie G.E. Moore (1922) es ausdrückte, als „durchsichtig“ bezeichnet. Wir „blicken durch“ unsere Sinneserfahrungen hindurch, insofern wir uns der äußeren Objekte und Ereignisse, die uns präsentiert werden, direkt bewusst zu sein scheinen, anstatt uns der Eigenschaften der Erfahrung bewusst zu sein, durch die sie uns diese Objekte präsentiert oder repräsentiert. Wenn ich auf die vom Winde verwehte Wiese schaue, ist es das wogende grüne Gras, dessen ich mir bewusst bin, nicht irgendeine grüne Eigenschaft meiner visuellen Erfahrung. (Siehe den Eintrag über Repräsentationstheorien des Bewusstseins.) Moore selbst glaubte, dass wir uns dieser letzteren Eigenschaften durch Anstrengung und Umlenkung der Aufmerksamkeit bewusst werden können, obwohl einige zeitgenössische Verfechter der Transparenz dies bestreiten (Harman 1990, Tye 1995, Kind 2003).
Bewusste Gedanken und Erfahrungen sind auch in einem semantischen Sinne transparent, denn ihre Bedeutung scheint uns unmittelbar bekannt zu sein, wenn wir sie denken (Van Gulick 1992). In diesem Sinne könnte man sagen, dass wir sie „direkt durchdenken“, um herauszufinden, was sie bedeuten oder darstellen. Transparenz in diesem semantischen Sinne kann zumindest teilweise mit dem übereinstimmen, was John Searle die „intrinsische Intentionalität“ des Bewusstseins nennt (Searle 1992).
Unsere bewussten mentalen Zustände scheinen ihre Bedeutung intrinsisch oder von innen heraus zu haben, einfach dadurch, dass sie das sind, was sie sind. Dies steht im Gegensatz zu vielen externalistischen Theorien mentaler Inhalte, die die Bedeutung auf kausale, kontrafaktische oder informationelle Beziehungen zwischen den Trägern der Intentionalität und ihren semantischen oder referenziellen Objekten gründen.
Die Auffassung, dass bewusste Inhalte intrinsisch determiniert und intern selbstverständlich sind, wird manchmal durch Appelle an die „Brain in the vat“-Intuition gestützt, die den Anschein erweckt, dass die bewussten mentalen Zustände des umhüllten Gehirns alle ihre normalen intentionalen Inhalte beibehalten würden, auch wenn alle ihre normalen kausalen und informationellen Verbindungen zur Welt verloren gegangen sind (Horgan und Tienson 2002). Es gibt eine anhaltende Kontroverse über solche Fälle und über konkurrierende internalistische (Searle 1992) und externalistische Ansichten (Dretske 1995) über bewusste Intentionalität.
Obwohl semantische Transparenz und intrinsische Intentionalität einige Gemeinsamkeiten aufweisen, sollten sie nicht einfach gleichgesetzt werden, da es möglich sein kann, den ersteren Begriff innerhalb einer eher externalistischen Darstellung von Inhalt und Bedeutung unterzubringen. Sowohl die semantische als auch die sensorische Transparenz betreffen offensichtlich die repräsentativen oder intentionalen Aspekte des Bewusstseins, aber sie sind auch erfahrungsbezogene Aspekte unseres bewussten Lebens. Sie sind Teil dessen, wie es ist oder wie es sich phänomenal anfühlt, bewusst zu sein. Beide haben auch funktionale Aspekte, insofern als bewusste Erfahrungen auf reichhaltige, inhaltsadäquate Weise miteinander interagieren, die unser transparentes Verständnis ihrer Inhalte manifestieren.
4.8 Dynamischer Fluss
Die Dynamik des Bewusstseins zeigt sich in der kohärenten Ordnung seines sich ständig verändernden Prozesses des Fließens und der Selbstumwandlung, was William James (1890) als „Bewusstseinsstrom“ bezeichnete. Einige zeitliche Abfolgen von Erfahrungen werden durch rein innere Faktoren erzeugt, wie z.B. wenn man über ein Rätsel nachdenkt, und andere hängen zum Teil von äußeren Ursachen ab, wie z. B. wenn man einem Flugball hinterherjagt, aber selbst die letztgenannten Abfolgen werden zu einem großen Teil dadurch geformt, wie sich das Bewusstsein selbst verwandelt.
Ob nun teilweise als Reaktion auf äußere Einflüsse oder vollständig aus dem Inneren heraus, jede Erfahrungssequenz von Moment zu Moment wächst kohärent aus denen heraus, die ihr vorausgingen, eingeschränkt und ermöglicht durch die globale Struktur von Verbindungen und Grenzen, die in der ihr zugrunde liegenden früheren Organisation verkörpert ist (Husserl 1913). In dieser Hinsicht ist das Bewusstsein ein autopoietisches System, d.h. ein sich selbst erschaffendes und selbst organisierendes System (Varela und Maturana 1980).
Als bewusster mentaler Akteur kann ich viele Dinge tun, z. B. mein Zimmer abtasten, ein mentales Bild davon abtasten, im Gedächtnis die Gänge eines kürzlich eingenommenen Restaurantessens zusammen mit vielen seiner Geschmäcker und Gerüche Revue passieren lassen, mir meinen Weg durch ein komplexes Problem denken oder einen Lebensmitteleinkauf planen und diesen Plan ausführen, wenn ich auf dem Markt ankomme. Dies sind alles routinemäßige und alltägliche Tätigkeiten, aber jede von ihnen beinhaltet die gezielte Erzeugung von Erfahrungen auf eine Art und Weise, die ein implizites praktisches Verständnis ihrer absichtlichen Eigenschaften und miteinander verbundenen Inhalte offenbart (Van Gulick 2000).
Das Bewusstsein ist ein dynamischer Prozess, und daher muss eine angemessene beschreibende Antwort auf die Was-Frage mehr als nur seine statischen oder momentanen Eigenschaften behandeln. Sie muss insbesondere die zeitliche Dynamik des Bewusstseins und die Art und Weise beschreiben, in der sein sich selbst verändernder Fluss sowohl seine intentionale Kohärenz als auch das semantische Selbstverständnis widerspiegelt, das in den organisierten Kontrollen verkörpert ist, durch die sich das Bewusstsein als autopoietisches System, das sich mit seiner Welt auseinandersetzt, ständig neu gestaltet.
Eine umfassende Beschreibung des Bewusstseins müsste sich mit mehr als nur diesen sieben Merkmalen befassen, aber eine klare Darstellung jedes dieser Merkmale würde uns bei der Beantwortung der Frage „Was ist Bewusstsein?“ weit voranbringen.
5. Die Erklärungsfrage: Wie kann Bewusstsein existieren?
Die Wie-Frage konzentriert sich eher auf die Erklärung als auf die Beschreibung. Sie fordert uns auf, den grundlegenden Status des Bewusstseins und seinen Platz in der Natur zu erklären. Ist es ein grundlegendes Merkmal der Realität an sich, oder hängt seine Existenz von anderen unbewussten Elementen ab, seien sie physikalisch, biologisch, neuronal oder rechnerisch? Und wenn letzteres der Fall ist, können wir dann erklären oder verstehen, wie die relevanten nicht-bewussten Elemente das Bewusstsein verursachen oder realisieren können? Einfach ausgedrückt: Können wir erklären, wie man aus Dingen, die nicht bewusst sind, etwas Bewusstes machen kann?
5.1 Die Vielfalt der Erklärungsprojekte
Die Wie-Frage ist keine Einzelfrage, sondern eher eine allgemeine Familie spezifischerer Fragen (Van Gulick 1995). Sie alle betreffen die Möglichkeit, irgendeine Art oder einen Aspekt des Bewusstseins zu erklären, aber sie unterscheiden sich in ihren besonderen Explananda, den Einschränkungen ihrer Explanans und ihren Kriterien für eine erfolgreiche Erklärung. So könnte man beispielsweise fragen, ob wir das Zugriffsbewusstsein rechnerisch erklären können, indem wir die erforderlichen Zugriffsbeziehungen in einem Computermodell nachbilden. Oder man könnte sich stattdessen mit der Frage beschäftigen, ob die phänomenalen und qualitativen Eigenschaften des Geistes eines bewussten Lebewesens a priori aus einer Beschreibung der neuronalen Eigenschaften seiner Gehirnprozesse abgeleitet werden können. Beides sind Versionen der Wie-Frage, aber sie fragen nach den Aussichten sehr unterschiedlicher Erklärungsprojekte und können sich daher in ihren Antworten unterscheiden (Lycan 1996). Es wäre unpraktisch, wenn nicht gar unmöglich, alle möglichen Versionen der Wie-Frage zu katalogisieren, aber einige der wichtigsten Optionen können aufgeführt werden.
Explananda. Zu den möglichen Erklärungen gehören die verschiedenen Arten von Zustands- und Geschöpfesbewusstsein, die oben unterschieden wurden, sowie die sieben Merkmale des Bewusstseins, die in der Antwort auf die Was-Frage aufgeführt sind. Diese beiden Arten von Explananda überschneiden und überlagern sich. Wir könnten zum Beispiel versuchen, den dynamischen Aspekt entweder des phänomenalen oder des Zugangsbewusstseins zu erklären. Oder wir könnten versuchen, die Subjektivität entweder des qualitativen oder des meta-mentalen Bewusstseins zu erklären. Nicht jedes Merkmal trifft auf jede Art von Bewusstsein zu, aber alle treffen auf mehrere zu. Die Art und Weise, wie man ein bestimmtes Merkmal in Bezug auf eine Art von Bewusstsein erklärt, entspricht möglicherweise nicht dem, was man braucht, um es in Bezug auf eine andere Art von Bewusstsein zu erklären.
Explanans. Das Spektrum der möglichen Explanans ist ebenfalls vielfältig. In ihrer vielleicht weitesten Form fragt die Wie-Frage danach, wie das Bewusstsein der betreffenden Art durch unbewusste Dinge verursacht oder realisiert werden könnte, aber wir können eine Fülle spezifischerer Fragen stellen, indem wir die Bandbreite der relevanten Explanans weiter einschränken. Man könnte versuchen zu erklären, wie ein bestimmtes Merkmal des Bewusstseins durch zugrundeliegende neuronale Prozesse, biologische Strukturen, physikalische Mechanismen, funktionale oder teleofunktionale Beziehungen, rechnerische Organisation oder sogar durch unbewusste mentale Zustände verursacht oder realisiert wird. Die Aussichten auf einen Erklärungserfolg sind entsprechend unterschiedlich. Im Allgemeinen gilt: Je begrenzter und elementarer der Bereich des Explanans, desto schwieriger ist das Problem zu erklären, wie es ausreichen könnte, um Bewusstsein zu erzeugen (Van Gulick 1995).
Kriterien der Erklärung. Der dritte Schlüsselparameter ist, wie man das Kriterium für eine erfolgreiche Erklärung definiert. Man könnte verlangen, dass das Explanandum a priori aus dem Explanans ableitbar ist, obwohl es umstritten ist, ob dies ein notwendiges oder ausreichendes Kriterium für die Erklärung des Bewusstseins ist (Jackson 1993). Ob es hinreichend ist, hängt zum Teil von der Art der Prämissen ab, von denen die Deduktion ausgeht. In der Logik braucht man einige Brückenprinzipien, um Aussagen oder Sätze über das Bewusstsein mit solchen zu verbinden, die es nicht erwähnen. Wenn die Prämissen physikalische oder neuronale Fakten betreffen, dann braucht man einige Brückenprinzipien oder Verbindungen, die solche Fakten mit Fakten über das Bewusstsein verbinden (Kim 1998). „Brute Links“, seien es nomische oder lediglich gut bestätigte Korrelationen, könnten eine logisch ausreichende Brücke darstellen, um Schlussfolgerungen über das Bewusstsein zu ziehen. Aber sie würden es uns wahrscheinlich nicht erlauben zu sehen, wie oder warum diese Verbindungen bestehen, und daher würden sie nicht ausreichen, um vollständig zu erklären, wie Bewusstsein existiert (Levine 1983, 1993, McGinn 1991).
Man könnte berechtigterweise nach mehr fragen, insbesondere nach einer Erklärung, die verständlich macht, warum diese Zusammenhänge bestehen und warum sie vielleicht nicht ausbleiben können. Häufig wird ein bekanntes zweistufiges Modell zur Erklärung von Makroeigenschaften anhand von Mikrosubstraten herangezogen. Im ersten Schritt analysiert man die Makroeigenschaft im Hinblick auf funktionale Bedingungen, und im zweiten Schritt zeigt man dann, dass die Mikrostrukturen, die den Gesetzen ihrer eigenen Ebene gehorchen, nomischerweise ausreichen, um die Erfüllung der relevanten funktionalen Bedingungen zu gewährleisten (Armstrong 1968, Lewis 1972).
Die Mikroeigenschaften von Ansammlungen von H2O-Molekülen bei 20°C genügen, um die Bedingungen für die Liquidität des Wassers, das sie bilden, zu erfüllen. Außerdem macht das Modell verständlich, wie die Liquidität durch die Mikroeigenschaften erzeugt wird. Eine zufriedenstellende Erklärung für die Entstehung des Bewusstseins scheint eine ähnliche zweistufige Geschichte zu erfordern. Ohne diese könnte sogar die Ableitbarkeit a priori als erklärend unzureichend erscheinen, obwohl die Notwendigkeit einer solchen Geschichte nach wie vor umstritten ist (Block und Stalnaker 1999, Chalmers und Jackson 2001).
5.2 Die Erklärungslücke
Unser derzeitiges Unvermögen, eine angemessen verständliche Verbindung herzustellen, wird manchmal in Anlehnung an Joseph Levine (1983) als das Vorhandensein einer Erklärungslücke beschrieben sowie als Hinweis auf unser unvollständiges Verständnis der Frage, wie das Bewusstsein von einem unbewussten Substrat, insbesondere einem physischen Substrat, abhängen könnte. Die grundlegende Behauptung einer Erklärungslücke lässt viele Variationen in Bezug auf die Allgemeinheit und damit auch auf die Stärke zu.
In ihrer vielleicht schwächsten Form behauptet sie eine praktische Begrenzung unserer derzeitigen Erklärungsfähigkeiten; mit unseren derzeitigen Theorien und Modellen können wir keine verständliche Verbindung herstellen. Eine stärkere Version stellt eine prinzipielle Behauptung über unsere menschlichen Fähigkeiten auf und behauptet daher, dass wir angesichts unserer menschlichen kognitiven Grenzen niemals in der Lage sein werden, die Kluft zu überbrücken. Für uns oder für Geschöpfe, die uns kognitiv ähnlich sind, muss es ein Resträtsel bleiben (McGinn 1991). Colin McGinn (1995) hat argumentiert, dass wir Menschen angesichts des inhärent räumlichen Charakters sowohl unserer menschlichen Wahrnehmungskonzepte als auch der wissenschaftlichen Konzepte, die wir daraus ableiten, konzeptionell nicht in der Lage sind, die Natur der psychophysischen Verbindung zu verstehen. Fakten über diese Verbindung sind uns kognitiv ebenso verschlossen wie Fakten über Multiplikation oder Quadratwurzeln für Gürteltiere. Sie fallen nicht in unser begriffliches und kognitives Repertoire. Eine noch stärkere Version der Lückenbehauptung hebt die Beschränkung auf unsere kognitive Natur auf und bestreitet grundsätzlich, dass die Lücke durch irgendwelche kognitiven Agenten geschlossen werden kann.
Diejenigen, die Lückenbehauptungen aufstellen, sind sich uneins darüber, welche metaphysischen Schlussfolgerungen, wenn überhaupt, aus unseren angeblichen epistemischen Grenzen folgen. Levine selbst zögert, irgendwelche anti-physikalischen ontologischen Schlussfolgerungen zu ziehen (Levine 1993, 2001). Andererseits haben einige Neodualisten versucht, die Existenz der Lücke zu nutzen, um den Physikalismus zu widerlegen (Foster 1996, Chalmers 1996). Je stärker die erkenntnistheoretische Prämisse, desto größer die Hoffnung, eine metaphysische Schlussfolgerung abzuleiten. Es überrascht daher nicht, dass dualistische Schlussfolgerungen oft mit dem Verweis auf die angebliche prinzipielle Unmöglichkeit, die Lücke zu schließen, untermauert werden.
Wenn man a priori sehen könnte, dass es keine Möglichkeit gibt, das Bewusstsein auf verständliche Weise als aus dem Physischen hervorgehend zu erklären, wäre es kein großer Schritt zu dem Schluss, dass es dies tatsächlich nicht tut (Chalmers 1996). Doch gerade die Stärke einer solchen erkenntnistheoretischen Behauptung macht es schwierig, das fragliche metaphysische Ergebnis als gegeben anzunehmen. Wer also eine starke prinzipielle Lückenbehauptung zur Widerlegung des Physikalismus verwenden will, muss unabhängige Gründe finden, um sie zu stützen. Einige haben sich auf Argumente der Vorstellbarkeit berufen, wie z. B. die angebliche Vorstellbarkeit von Zombies, die molekular mit bewussten Menschen identisch sind, aber kein phänomenales Bewusstsein haben (Campbell 1970, Kirk 1974, Chalmers 1996). Andere unterstützende Argumente berufen sich auf die vermeintlich nicht-funktionale Natur des Bewusstseins und damit auf seinen angeblichen Widerstand gegen die wissenschaftliche Standardmethode, komplexe Eigenschaften (z. B. genetische Dominanz) durch physikalisch realisierte funktionale Bedingungen zu erklären (Block 1980a, Chalmers 1996). Solche Argumente vermeiden es, die antiphysikalische Frage zu stellen, aber sie stützen sich auf Behauptungen und Intuitionen, die umstritten und nicht völlig unabhängig von der grundsätzlichen Einstellung zum Physikalismus sind. Die Diskussion über dieses Thema ist nach wie vor aktiv und wird fortgesetzt.
Unsere derzeitige Unfähigkeit, einen Weg zur Schließung der Lücke zu sehen, mag einen gewissen Einfluss auf unsere Intuition ausüben, aber sie spiegelt vielleicht einfach die Grenzen unserer derzeitigen Theoriebildung wider und nicht eine prinzipiell unüberbrückbare Barriere (Dennett 1991). Darüber hinaus haben einige Physikalisten argumentiert, dass Erklärungslücken zu erwarten sind und sogar durch plausible Versionen des ontologischen Physikalismus bedingt werden, die menschliche Akteure als physisch realisierte kognitive Systeme mit inhärenten Grenzen behandeln, die sich aus ihrem evolutionären Ursprung und ihrer situierten kontextuellen Art des Verstehens ergeben (Van Gulick 1985, 2003; McGinn 1991, Papineau 1995, 2002). Nach dieser Auffassung widerlegt das Vorhandensein von Erklärungslücken den Physikalismus nicht, sondern kann ihn vielmehr bestätigen. Die Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten zu diesen Themen sind nach wie vor aktiv und anhaltend.
5.3 Reduktive und nicht-reduktive Erklärung
Wie die Notwendigkeit einer verständlichen Verknüpfung gezeigt hat, ist die Ableitbarkeit a priori an sich nicht offensichtlich ausreichend für eine erfolgreiche Erklärung (Kim 1980), noch ist sie eindeutig notwendig. In vielen Erklärungskontexten könnte eine schwächere logische Verbindung ausreichen. Wir können manchmal genug darüber erzählen, wie Fakten einer Art von denen einer anderen abhängen, um uns davon zu überzeugen, dass letztere die ersteren tatsächlich verursachen oder verwirklichen, auch wenn wir nicht alle ersteren Fakten strikt aus den letzteren ableiten können.
Die strenge intertheoretische Deduktion wurde von der logisch-empirischen Darstellung der Einheit der Wissenschaften (Putnam und Oppenheim 1958) als reduktive Norm angenommen, aber in den letzten Jahrzehnten hat sich ein lockereres, nicht-reduktives Bild der Beziehungen zwischen den verschiedenen Wissenschaften durchgesetzt. Insbesondere nicht-reduktive Materialisten haben für die so genannte „Autonomie der Spezialwissenschaften“ (Fodor 1974) und für die Ansicht argumentiert, dass das Verständnis der natürlichen Welt die Verwendung einer Vielfalt von Begriffs- und Darstellungssystemen erfordert, die nicht unbedingt übersetzbar sind oder in die enge Korrespondenz gebracht werden können, die das ältere deduktive Paradigma der Beziehungen zwischen den Ebenen verlangt (Putnam 1975).
Die Wirtschaftswissenschaften werden oft als Beispiel angeführt (Fodor 1974, Searle 1992). Wirtschaftliche Tatsachen können durch zugrunde liegende physikalische Prozesse realisiert werden, aber niemand verlangt ernsthaft, dass wir in der Lage sind, die relevanten wirtschaftlichen Tatsachen aus detaillierten Beschreibungen ihrer zugrunde liegenden physikalischen Grundlagen abzuleiten, oder dass wir in der Lage sind, die Konzepte und das Vokabular der Wirtschaftswissenschaften in enge Korrespondenz mit denen der Naturwissenschaften zu bringen.
Nichtsdestotrotz wird unsere Unfähigkeit zur Deduktion nicht als Grund für ontologische Bedenken gesehen; es gibt kein „Geld-Materie“-Problem. Alles, was wir brauchen, ist ein allgemeines und nicht nur deduktives Verständnis davon, wie ökonomische Eigenschaften und Beziehungen durch physikalische unterlegt werden können. So könnte man sich für ein ähnliches Kriterium entscheiden, wenn es um die Interpretation der Wie-Frage geht und darum, was als Erklärung dafür gilt, wie Bewusstsein durch unbewusste Dinge verursacht oder realisiert werden kann. Einige Kritiker, wie z. B. Kim (1987), haben jedoch die Kohärenz einer Ansicht in Frage gestellt, die darauf abzielt, sowohl nicht-reduktiv als auch physikalisch zu sein, obwohl Befürworter einer solchen Ansicht ihrerseits geantwortet haben (Van Gulick 1993).
Andere haben argumentiert, dass das Bewusstsein aufgrund der inhärenten Unterschiede zwischen unserer subjektiven und objektiven Art des Verstehens besonders widerstandsfähig gegenüber physikalischen Erklärungen ist. Thomas Nagel hat berühmt argumentiert (1974), dass unserer Fähigkeit, die Phänomenologie der Fledermauserfahrung zu verstehen, unvermeidliche Grenzen gesetzt sind, weil wir nicht in der Lage sind, empathisch eine Erfahrungsperspektive einzunehmen, wie sie für die echo-ortbare Hörerfahrung der Fledermaus charakteristisch ist. Da wir nicht in der Lage sind, eine ähnliche Erfahrung zu machen, können wir die Natur einer solchen Erfahrung bestenfalls teilweise verstehen. Kein noch so großes Wissen, das wir aus der externen objektiven Dritte-Person-Perspektive der Naturwissenschaften gewonnen haben, wird ausreichen, um zu verstehen, was die Fledermaus aus ihrer internen subjektiven Ich-Perspektive über ihre eigene Erfahrung verstehen kann.
5.4 Aussichten auf erklärerische Erfolge
Die Frage nach dem „Wie“ unterteilt sich somit in eine Vielzahl spezifischerer Fragen, je nachdem, welche Art oder Eigenschaft des Bewusstseins man erklären will, welche spezifischen Beschränkungen man für die Reichweite des „Explanans“ aufstellt und welches Kriterium man zur Definition des Erklärungserfolgs verwendet. Einige der sich daraus ergebenden Varianten scheinen leichter zu beantworten zu sein als andere. Bei einigen der so genannten „einfachen Probleme“ des Bewusstseins, wie der Erklärung der Dynamik des Zugriffs auf das Bewusstsein durch die funktionelle oder rechnerische Organisation des Gehirns (Baars 1988), scheinen Fortschritte wahrscheinlich. Andere scheinen weniger gut lösbar zu sein, insbesondere das so genannte „harte Problem“ (Chalmers 1995), bei dem es mehr oder weniger darum geht, eine verständliche Erklärung zu liefern, die uns auf intuitiv befriedigende Weise erkennen lässt, wie phänomenales oder „Wie es ist“-Bewusstsein aus physikalischen oder neuronalen Prozessen im Gehirn entstehen könnte.
Positive Antworten auf einige Versionen der „Wie“-Fragen scheinen in greifbarer Nähe zu sein, andere hingegen bleiben zutiefst rätselhaft. Auch sollten wir nicht davon ausgehen, dass es auf jede Version eine positive Antwort gibt. Wenn der Dualismus wahr ist, dann könnte das Bewusstsein zumindest in einigen seiner Formen grundlegend und fundamental sein. Wenn dies der Fall ist, können wir nicht erklären, wie es aus unbewussten Dingen entsteht, da es dies einfach nicht tut.
Wie man die Aussichten auf eine Erklärung des Bewusstseins einschätzt, hängt in der Regel von der eigenen Perspektive ab. Optimistische Physikalisten werden die gegenwärtigen Erklärungslücken wahrscheinlich nur als Ausdruck des frühen Stadiums der Forschung betrachten, das in nicht allzu ferner Zukunft behoben werden wird (Dennett 1991, Searle 1992, P. M. Churchland 1995). Für die Dualisten bedeuten dieselben Sackgassen den Bankrott des physikalischen Programms und die Notwendigkeit, das Bewusstsein als einen grundlegenden Bestandteil der Realität anzuerkennen (Robinson 1982, Foster 1989, 1996, Chalmers 1996). Was man sieht, hängt zum Teil davon ab, wo man steht, und das laufende Projekt zur Erklärung des Bewusstseins wird von einer anhaltenden Debatte über seinen Status und seine Erfolgsaussichten begleitet.
6. Die funktionale Frage: Warum existiert das Bewusstsein?
Die Funktions- oder Warum-Frage fragt nach dem Wert oder der Rolle des Bewusstseins und damit indirekt nach seinem Ursprung. Hat es eine Funktion, und wenn ja, wie lautet sie? Hat es einen Einfluss auf die Funktionsweise von Systemen, in denen es vorhanden ist, und wenn ja, warum und wie? Wenn das Bewusstsein als komplexes Merkmal biologischer Systeme existiert, dann ist sein adaptiver Wert wahrscheinlich relevant, um seinen evolutionären Ursprung zu erklären, obwohl seine gegenwärtige Funktion, falls es eine hat, natürlich nicht die gleiche sein muss wie die, die es vielleicht hatte, als es zum ersten Mal auftrat. Adaptive Funktionen ändern sich oft im Laufe der biologischen Zeit. Die Frage nach dem Wert des Bewusstseins hat in mindestens zweierlei Hinsicht auch eine moralische Dimension. Wir neigen dazu, den moralischen Status eines Organismus zumindest teilweise durch die Art und das Ausmaß seines Bewusstseins zu bestimmen, und Bewusstseinszustände, insbesondere bewusste affektive Zustände wie Freude und Schmerz, spielen eine wichtige Rolle in vielen der Wertvorstellungen, die der Moraltheorie zugrunde liegen (Singer 1975).
Wie die Fragen nach dem Was und dem Wie stellt auch die Frage nach dem Warum ein allgemeines Problem dar, das sich in eine Vielzahl von spezifischeren Fragen aufteilt. Insofern die verschiedenen Arten des Bewusstseins, z. B. Zugang, phänomenal, meta-mental, unterschiedlich und trennbar sind – was eine offene Frage bleibt -, unterscheiden sie sich wahrscheinlich auch in ihren spezifischen Rollen und Werten. Auf die Frage nach dem Warum gibt es daher möglicherweise keine einzige oder einheitliche Antwort.
6.1 Kausaler Status des Bewusstseins
Das vielleicht grundlegendste Problem, das jede Version der Warum-Frage aufwirft, ist die Frage, ob das Bewusstsein der relevanten Art überhaupt eine kausale Wirkung hat oder nicht. Wenn es keine Wirkungen hat und keinerlei kausalen Unterschied macht, dann scheint es in den Systemen oder Organismen, in denen es vorhanden ist, keine bedeutende Rolle spielen zu können, wodurch die meisten Untersuchungen über seinen möglichen Wert von vornherein untergraben werden. Auch die Gefahr der epiphänomenalen Irrelevanz kann nicht einfach als offensichtliche Nicht-Option abgetan werden, da zumindest einige Formen des Bewusstseins in der neueren Literatur ernsthaft als nicht kausal eingestuft werden (siehe den Eintrag über Epiphänomenalismus) Solche Bedenken wurden insbesondere in Bezug auf Qualia und qualitatives Bewusstsein geäußert (Huxley 1874, Jackson 1982, Chalmers 1996), aber auch der kausale Status anderer Arten, einschließlich des meta-mentalen Bewusstseins, wurde in Frage gestellt (Velmans 1991).
Zur Untermauerung solcher Behauptungen wurden sowohl metaphysische als auch empirische Argumente angeführt. Zu den ersteren gehören diejenigen, die sich auf Intuitionen über die Vorstellbarkeit und logische Möglichkeit von Zombies berufen, d. h. von Wesen, deren Verhalten, funktionelle Organisation und physische Struktur bis hinunter zur molekularen Ebene mit denen normaler menschlicher Akteure identisch sind, denen aber jegliche Qualia oder qualitatives Bewusstsein fehlt. Einige (Kirk 1970, Chalmers 1996) behaupten, dass solche Wesen in Welten, die alle unsere physikalischen Gesetze teilen, möglich sind, aber andere bestreiten dies (Dennett 1991, Levine 2001). Wenn sie in solchen Welten möglich sind, dann scheint daraus zu folgen, dass Qualia auch in unserer Welt den Verlauf physikalischer Ereignisse, einschließlich derer, die unser menschliches Verhalten ausmachen, nicht beeinflussen. Wenn diese Ereignisse auf die gleiche Weise ablaufen, ob Qualia vorhanden sind oder nicht, dann scheinen Qualia zumindest in Bezug auf Ereignisse in der physischen Welt inert oder epiphänomenal zu sein. Solche Argumente und die Zombie-Intuitionen, auf denen sie beruhen, sind jedoch umstritten und ihre Stichhaltigkeit bleibt umstritten (Searle 1992, Yablo 1998, Balog 1999).
Argumente einer weitaus empirischeren Art haben den kausalen Status des meta-mentalen Bewusstseins in Frage gestellt, zumindest insoweit, als dessen Vorhandensein durch die Fähigkeit, über den eigenen mentalen Zustand zu berichten, gemessen werden kann. Es wird behauptet, dass wissenschaftliche Beweise zeigen, dass diese Art von Bewusstsein weder für irgendeine Art von mentaler Fähigkeit notwendig ist, noch früh genug auftritt, um als Ursache für die Handlungen oder Prozesse zu fungieren, die üblicherweise als ihre Auswirkungen angesehen werden (Velmans 1991). Denjenigen zufolge, die solche Argumente vorbringen, können alle Arten von geistigen Fähigkeiten, von denen man normalerweise annimmt, dass sie Bewusstsein erfordern, unbewusst realisiert werden, wenn das angeblich erforderliche Selbstbewusstsein fehlt.
Und selbst wenn ein bewusstes Selbstbewusstsein vorhanden ist, tritt es angeblich zu spät auf, um die Ursache der betreffenden Handlungen zu sein und nicht deren Ergebnis oder bestenfalls eine gemeinsame Wirkung einer gemeinsamen früheren Ursache (Libet 1985). Das Selbstbewusstsein oder das meta-mentale Bewusstsein erweist sich nach diesen Argumenten eher als ein psychologischer Nacheffekt denn als eine auslösende Ursache, eher wie ein nachträglicher Ausdruck oder das auf dem Computerbildschirm angezeigte Ergebnis als die eigentlichen Prozessoroperationen, die sowohl die Reaktion des Computers als auch seine Anzeige erzeugen.
Auch hier sind die Argumente umstritten, und sowohl die angenommenen Daten als auch ihre Interpretation sind Gegenstand lebhafter Meinungsverschiedenheiten (siehe Flanagan 1992 und die Kommentare zu Velmans 1991). Obwohl die empirischen Argumente ebenso wie die Zombie-Behauptungen ernsthaft die Frage aufwerfen, ob einige Formen des Bewusstseins weniger kausal wirksam sind, als typischerweise angenommen wird, betrachten viele Theoretiker die empirischen Daten als keine echte Bedrohung für den kausalen Status des Bewusstseins.
Wenn die Epiphänomenalisten falsch liegen und das Bewusstsein in seinen verschiedenen Formen tatsächlich kausal ist, welche Art von Auswirkungen hat es dann und welche Unterschiede macht es aus? Wie unterscheiden sich mentale Prozesse, an denen die relevante Art von Bewusstsein beteiligt ist, von solchen, bei denen es fehlt? Welche Funktion(en) könnte(n) das Bewusstsein erfüllen? In den folgenden sechs Abschnitten (6.2-6.7) werden einige der am häufigsten gegebenen Antworten diskutiert. Obwohl sich die verschiedenen Funktionen bis zu einem gewissen Grad überschneiden, ist jede von ihnen unterschiedlich, und sie unterscheiden sich auch in der Art des Bewusstseins, mit dem sie am ehesten in Verbindung gebracht werden können.
6.2 Flexible Kontrolle
Erhöhte Flexibilität und Raffinesse der Kontrolle. Bewusste mentale Prozesse scheinen sehr flexible und anpassungsfähige Formen der Kontrolle zu ermöglichen. Obwohl unbewusste automatische Prozesse äußerst effizient und schnell sein können, funktionieren sie in der Regel auf eine Art und Weise, die starrer und vorbestimmter ist als jene, die bewusste Selbstwahrnehmung beinhaltet (Anderson 1983). Die bewusste Wahrnehmung ist daher besonders wichtig, wenn man sich mit neuartigen Situationen und bisher unbekannten Problemen oder Anforderungen auseinandersetzt (Penfield 1975, Armstrong 1981).
Standarddarstellungen zum Erwerb von Fertigkeiten betonen die Bedeutung der bewussten Wahrnehmung während der anfänglichen Lernphase, die allmählich automatischen Prozessen weicht, die wenig Aufmerksamkeit oder bewusste Kontrolle erfordern (Schneider und Shiffrin 1977). Die bewusste Verarbeitung ermöglicht die Konstruktion oder Zusammenstellung spezifisch zugeschnittener Routinen aus elementaren Einheiten sowie die bewusste Kontrolle ihrer Ausführung.
Es gibt einen bekannten Kompromiss zwischen Flexibilität und Geschwindigkeit; kontrollierte bewusste Prozesse erkaufen ihre maßgeschneiderte Vielseitigkeit mit Langsamkeit und Anstrengung im Gegensatz zu der flüssigen Schnelligkeit automatischer unbewusster mentaler Operationen (Anderson 1983). Die entsprechenden Flexibilitätssteigerungen scheinen am engsten mit der meta-mentalen oder höherwertigen Form des Bewusstseins verbunden zu sein, insofern als die verbesserte Fähigkeit, Prozesse zu kontrollieren, von einer größeren Selbstwahrnehmung abhängt. Flexibilität und ausgefeilte Formen der Kontrolle können jedoch auch mit den phänomenalen und Zugangsformen des Bewusstseins in Verbindung gebracht werden.
6.3 Soziale Koordinierung
Verbesserte Fähigkeit zur sozialen Koordination. Bewusstsein im meta-mentalen Sinne kann nicht nur eine gesteigerte Selbstwahrnehmung beinhalten, sondern auch ein verbessertes Verständnis der mentalen Zustände anderer Lebewesen, insbesondere derjenigen anderer Mitglieder der eigenen sozialen Gruppe (Humphreys 1982). Lebewesen, die im relevanten meta-mentalen Sinne bewusst sind, haben nicht nur Überzeugungen, Motive, Wahrnehmungen und Absichten, sondern verstehen auch, was es bedeutet, solche Zustände zu haben, und sind sich sowohl ihrer selbst als auch der Tatsache bewusst, dass andere sie haben.
Dieser Zuwachs an gemeinsamem Wissen über die Gedanken der anderen ermöglicht es den betreffenden Organismen, auf fortgeschrittenere und anpassungsfähigere Weise zu interagieren, zu kooperieren und zu kommunizieren. Obwohl das meta-mentale Bewusstsein am offensichtlichsten mit einer solchen sozial koordinativen Rolle verbunden ist, ist das narrative Bewusstsein, wie es mit dem Bewusstseinsstrom assoziiert wird, auch insofern relevant, als es die Anwendung der Interpretationsfähigkeiten, die sich zum Teil aus ihrer sozialen Anwendung ergeben, auf den eigenen Fall beinhaltet (Ryle 1949, Dennett 1978, 1992).
6.4 Integrierte Darstellung
Eine einheitlichere und dichter integrierte Darstellung der Realität. Die bewusste Erfahrung präsentiert uns eine Welt von Objekten, die unabhängig voneinander in Raum und Zeit existieren. Diese Objekte werden uns typischerweise auf eine multimodale Weise präsentiert, die die Integration von Informationen aus verschiedenen Sinneskanälen sowie aus Hintergrundwissen und Gedächtnis beinhaltet. Bewusstes Erleben präsentiert uns nicht isolierte Eigenschaften oder Merkmale, sondern Objekte und Ereignisse, die in einer fortlaufenden, unabhängigen Welt angesiedelt sind, und zwar dadurch, dass es in seiner Erfahrungsorganisation und -dynamik das dichte Netz von Beziehungen und Verbindungen verkörpert, die gemeinsam die sinnvolle Struktur einer Welt von Objekten bilden (Kant 1787, Husserl 1913, Campbell 1997).
Natürlich müssen nicht alle sensorischen Informationen erlebt werden, um eine adaptive Wirkung auf das Verhalten zu haben. Adaptive sensorisch-motorische Verbindungen, die nicht auf Erfahrung beruhen, finden sich sowohl bei einfachen Organismen als auch bei einigen der direkteren und reflexiven Prozesse höherer Organismen. Wenn jedoch Erfahrung vorhanden ist, bietet sie eine einheitlichere und integriertere Darstellung der Realität, die in der Regel offenere Reaktionsmöglichkeiten zulässt (Lorenz 1977). Man betrachte beispielsweise die Repräsentation des Raums in einem Organismus, dessen sensorische Eingangskanäle lediglich mit der Bewegung oder der Ausrichtung einiger weniger feststehender Mechanismen verbunden sind, wie z. B. derjenigen für die Nahrungsaufnahme oder das Ergreifen von Beute, und vergleiche sie mit der Repräsentation in einem Organismus, der in der Lage ist, seine räumlichen Informationen für eine flexible Navigation in seiner Umgebung und für andere räumlich relevante Ziele zu nutzen, wie z. B. wenn eine Person ihr Büro oder ihre Küche visuell absucht (Gallistel 1990).
Es ist die letztgenannte Art der Darstellung, die typischerweise durch die mit der bewussten Erfahrung verbundene integrierte Darstellungsweise verfügbar gemacht wird. Die Einheit des erlebten Raums ist nur ein Beispiel für die Art der Integration, die mit unserer bewussten Wahrnehmung einer objektiven Welt verbunden ist (siehe den Eintrag über die Einheit des Bewusstseins).
Diese integrative Rolle oder dieser Wert ist am unmittelbarsten mit dem Zugangsbewusstsein verbunden, aber auch eindeutig mit der größeren phänomenalen und intentionalen Struktur der Erfahrung. Er ist sogar für den qualitativen Aspekt des Bewusstseins insofern relevant, als Qualia eine wichtige Rolle in unserer Erfahrung von vereinheitlichten Objekten in einem vereinheitlichten Raum oder einer vereinheitlichten Szene spielen. Sie ist auch eng mit der Transparenz der Erfahrung verbunden, die in der Antwort auf die Was-Frage beschrieben wurde, insbesondere mit der semantischen Transparenz (Van Gulick 1993). Die Integration von Informationen spielt eine wichtige Rolle in mehreren aktuellen neurokognitiven Theorien des Bewusstseins, insbesondere in den Theorien über den globalen Arbeitsraum (siehe Abschnitt 9.5) und in Giulio Tononis Theorie der integrierten Information (Abschnitt 9.6).
6.5 Informationeller Zugang
Globalerer Zugang zu Informationen. Die Informationen, die in bewussten mentalen Zuständen enthalten sind, können typischerweise von einer Vielzahl mentaler Subsysteme genutzt und auf eine breite Palette möglicher Situationen und Handlungen angewendet werden (Baars 1988). Unbewusste Informationen sind eher in bestimmten mentalen Modulen eingekapselt und können nur für die Anwendungen genutzt werden, die direkt mit dem Betrieb des jeweiligen Subsystems verbunden sind (Fodor 1983). Die Bewusstmachung von Informationen erweitert in der Regel den Bereich ihres Einflusses und die Möglichkeiten, sie zur adaptiven Steuerung oder Gestaltung des inneren und äußeren Verhaltens zu nutzen. Die Bewusstheit eines Zustands kann zum Teil eine Frage dessen sein, was Dennett als „zerebrale Berühmtheit“ bezeichnet, d. h. seiner Fähigkeit, einen inhaltlich angemessenen Einfluss auf andere mentale Zustände auszuüben.
Diese besondere Rolle ist am direktesten und definitionsgemäß mit dem Begriff des Zugriffsbewusstseins verbunden (Block 1995), aber auch das meta-mentale Bewusstsein sowie die phänomenalen und qualitativen Formen scheinen alle plausibel mit einer solchen Zunahme der Verfügbarkeit von Informationen verbunden zu sein (Armstrong 1981, Tye 1985). Verschiedene kognitive und neurokognitive Theorien beziehen den Zugang als ein zentrales Merkmal des Bewusstseins und der bewussten Verarbeitung ein. Globale Arbeitsraumtheorien, Prinz‘ „Attendend Intermediate Representation“ (AIR) (Prinz 2012) und Tononis „Integrierte Informationstheorie“ (IIT) unterscheiden Bewusstseinszustände und -prozesse zumindest teilweise im Hinblick auf einen verbesserten, weit verbreiteten Zugang zum Inhalt des Zustands (siehe Abschnitt 9.6).
6.6 Freiheit des Willens
Erhöhte Entscheidungsfreiheit oder freier Wille. Die Frage des freien Willens bleibt ein immerwährendes philosophisches Problem. Nicht nur in Bezug auf die Frage, ob es ihn gibt oder nicht, sondern sogar in Bezug auf die Frage, worin er bestehen könnte oder sollte (Dennett 1984, van Inwagen 1983, Hasker 1999, Wegner 2002). (Siehe den Eintrag über den freien Willen.) Der Begriff des freien Willens mag selbst noch zu undurchsichtig und umstritten sein, um die Rolle des Bewusstseins eindeutig zu erhellen, aber es gibt eine traditionelle Intuition, dass die beiden eng miteinander verbunden sind.
Man geht davon aus, dass das Bewusstsein einen Bereich von Möglichkeiten eröffnet, eine Sphäre von Optionen, innerhalb derer das bewusste Selbst frei wählen oder handeln kann. Zumindest scheint das Bewusstsein eine notwendige Vorbedingung für eine solche Freiheit oder Selbstbestimmung zu sein (Hasker 1999). Wie könnte man die erforderliche freie Wahl treffen, wenn man sich ausschließlich im unbewussten Bereich bewegt? Wie kann man seinen eigenen Willen bestimmen, ohne sich dessen und der Möglichkeiten, die man hat, ihn zu gestalten, bewusst zu sein?
Die Freiheit, seine Handlungen zu wählen, und die Fähigkeit, sein Wesen und seine künftige Entwicklung selbst zu bestimmen, kann viele interessante Variationen und Abstufungen zulassen, anstatt eine einfache Alles-oder-Nichts-Angelegenheit zu sein, und verschiedene Formen oder Ebenen des Bewusstseins könnten mit entsprechenden Graden oder Arten von Freiheit und Selbstbestimmung korreliert sein (Dennett 1984, 2003). Der Zusammenhang mit der Freiheit scheint am stärksten für die meta-mentale Form des Bewusstseins zu sein, da sie den Schwerpunkt auf die Selbstwahrnehmung legt, aber potenzielle Verbindungen scheinen auch für die meisten anderen Arten möglich.
6.7 Intrinsische Motivation
Intrinsisch motivierende Zustände. Zumindest einigen Bewusstseinszuständen scheint ihre motivierende Kraft intrinsisch zu sein. Insbesondere die funktionale und motivierende Rolle bewusster affektiver Zustände, wie z. B. Vergnügen und Schmerz, scheint ihrem Erfahrungscharakter inhärent und von ihren qualitativen und phänomenalen Eigenschaften untrennbar zu sein, auch wenn diese Ansicht in Frage gestellt wurde (Nelkin 1989, Rosenthal 1991). Der attraktive, positive, motivierende Aspekt eines Vergnügens scheint ein Teil des direkt erlebten phänomenalen Gefühls zu sein, ebenso wie der negative, affektive Charakter eines Schmerzes – zumindest im Falle normaler, nicht-pathologischer Erfahrung.
Es besteht erhebliche Uneinigkeit darüber, inwieweit das Gefühl und die motivierende Kraft des Schmerzes in abnormalen Fällen dissoziiert werden können, und einige haben die Existenz solcher intrinsisch motivierenden Aspekte gänzlich geleugnet (Dennett 1991). Zumindest im Normalfall scheint die negative motivierende Kraft des Schmerzes jedoch direkt in das Gefühl der Erfahrung selbst eingebaut zu sein.
Wie es dazu kommen konnte, ist nicht ganz klar, und vielleicht ist der Anschein einer intrinsischen und direkt erlebten motivierenden Kraft illusorisch. Wenn sie jedoch real ist, dann könnte sie eine der wichtigsten und evolutionär ältesten Aspekte sein, in denen das Bewusstsein einen Unterschied zu den mentalen Systemen und Prozessen macht, in denen es vorhanden ist (Humphreys 1992).
Es wurden noch weitere Vorschläge zu den möglichen Rollen und dem Wert des Bewusstseins gemacht, und diese sechs Vorschläge erschöpfen sicherlich nicht die Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz gehören sie zu den bekanntesten Hypothesen der letzten Zeit und geben einen guten Überblick über die Art der Antworten, die von denjenigen, die glauben, dass das Bewusstsein tatsächlich einen Unterschied macht, auf die Frage nach dem Warum gegeben wurden.
6.8 Konstitutive und kontingente Rollen
Ein weiterer Punkt erfordert eine Klärung der verschiedenen Aspekte, in denen die vorgeschlagenen Funktionen die Warum-Frage beantworten könnten. Insbesondere sollte man zwischen konstitutiven Fällen und Fällen kontingenter Realisierung unterscheiden. Im ersten Fall stellt die Erfüllung der Rolle das Bewusstsein im relevanten Sinne dar, während im zweiten Fall das Bewusstsein einer bestimmten Art nur eine von mehreren Möglichkeiten ist, wie die erforderliche Rolle realisiert werden kann (Van Gulick 1993).
So kann beispielsweise die globale Bereitstellung von Informationen zur Nutzung durch eine Vielzahl von Subsystemen und Verhaltensanwendungen ein Bewusstsein im Sinne des Zugangs darstellen. Selbst wenn die qualitativen und phänomenalen Formen des Bewusstseins eine hochgradig vereinheitlichte und dicht integrierte Repräsentation der objektiven Realität beinhalten, kann es im Gegensatz dazu möglich sein, Repräsentationen zu erzeugen, die diese funktionalen Merkmale aufweisen, aber nicht qualitativer oder phänomenaler Natur sind.
Die Tatsache, dass bei uns die Repräsentationsformen mit diesen Merkmalen auch qualitative und phänomenale Eigenschaften haben, könnte auf kontingente historische Fakten über die besondere Designlösung zurückzuführen sein, die sich in unserer evolutionären Vorfahrenschaft ergeben hat. Wenn dem so ist, gibt es vielleicht ganz andere Möglichkeiten, ein vergleichbares Ergebnis ohne qualitatives oder phänomenales Bewusstsein zu erzielen. Ob dies der richtige Weg ist, um über phänomenales und qualitatives Bewusstsein nachzudenken, ist unklar; vielleicht ist die Verbindung zu einer einheitlichen und dicht integrierten Repräsentation tatsächlich so eng und konstitutiv, wie es im Falle des Zugangsbewusstseins zu sein scheint (Carruthers 2000). Unabhängig davon, wie diese Frage gelöst wird, ist es wichtig, Konstitutionsansätze nicht mit kontingenten Realisierungsansätzen zu verwechseln, wenn es um die Funktion des Bewusstseins und die Beantwortung der Frage geht, warum es existiert (Chalmers 1996).
7. Theorien über das Bewusstsein
Als Antwort auf die Fragen nach dem „Was“, „Wie“ und „Warum“ wurden in den letzten Jahren viele Theorien über das Bewusstsein vorgeschlagen. Allerdings sind nicht alle Theorien des Bewusstseins Theorien über dieselbe Sache. Sie unterscheiden sich nicht nur in den spezifischen Arten des Bewusstseins, die sie zum Gegenstand haben, sondern auch in ihren theoretischen Zielen.
Die vielleicht größte Unterscheidung besteht zwischen allgemeinen metaphysischen Theorien, die darauf abzielen, das Bewusstsein im allgemeinen ontologischen Schema der Realität zu verorten, und spezifischeren Theorien, die detaillierte Erklärungen zu seiner Natur, seinen Merkmalen und seiner Rolle bieten. Die Grenze zwischen den beiden Arten von Theorien verschwimmt ein wenig, insbesondere insofern, als viele spezifische Theorien zumindest einige implizite Verpflichtungen in Bezug auf die allgemeineren metaphysischen Fragen enthalten. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, diese Unterteilung im Hinterkopf zu behalten, wenn man sich einen Überblick über die Bandbreite der aktuellen theoretischen Angebote verschafft.
8. Metaphysische Theorien des Bewusstseins
Allgemeine metaphysische Theorien bieten Antworten auf die bewusste Version des Leib-Seele-Problems: „Was ist der ontologische Status des Bewusstseins in Bezug auf die Welt der physischen Realität?“ Die verfügbaren Antworten entsprechen weitgehend den Standardoptionen für das Leib-Seele-Problem, einschließlich der Hauptversionen von Dualismus und Physikalismus.
8.1 Dualistische Theorien
Dualistische Theorien gehen davon aus, dass zumindest einige Aspekte des Bewusstseins außerhalb des Bereichs des Physischen liegen, aber die spezifischen Formen des Dualismus unterscheiden sich darin, welche Aspekte das sind (siehe den Eintrag über Dualismus).
Der Substanzdualismus, wie der traditionelle kartesianische Dualismus (Descartes 1644), geht von der Existenz sowohl physischer als auch nicht-physischer Substanzen aus. Solche Theorien schließen die Existenz nicht-physischer Geister oder Selbste als Entitäten ein, denen das Bewusstsein innewohnt. Obwohl der Substanzdualismus gegenwärtig weitgehend in Ungnade gefallen ist, hat er doch einige zeitgenössische Befürworter (Swinburne 1986, Foster 1989, 1996).
Der Eigenschaftsdualismus in seinen verschiedenen Versionen genießt derzeit eine größere Unterstützung. Alle diese Theorien behaupten die Existenz bewusster Eigenschaften, die weder mit physikalischen Eigenschaften identisch noch auf diese reduzierbar sind, die aber dennoch von denselben Dingen instanziiert werden können, die physikalische Eigenschaften instanziieren. In dieser Hinsicht könnten sie als Theorien mit dualem Aspekt klassifiziert werden. Sie gehen davon aus, dass einige Teile der Realität – Organismen, Gehirne, neuronale Zustände oder Prozesse – Eigenschaften zweier verschiedener und unzusammenhängender Arten instanziieren: physikalische Eigenschaften und bewusste, phänomenale oder qualitative Eigenschaften. Duale Aspekt- oder eigenschaftsdualistische Theorien lassen sich in mindestens drei verschiedene Typen unterteilen.
Der fundamentale Eigenschaftsdualismus betrachtet bewusste mentale Eigenschaften als grundlegende Bestandteile der Realität, die den fundamentalen physikalischen Eigenschaften wie der elektromagnetischen Ladung gleichgestellt sind. Sie können auf kausale und gesetzesähnliche Weise mit anderen fundamentalen Eigenschaften wie denen der Physik interagieren, aber ontologisch ist ihre Existenz weder von anderen Eigenschaften abhängig noch von ihnen abgeleitet (Chalmers 1996).
Der Emergenz-Eigenschafts-Dualismus geht davon aus, dass bewusste Eigenschaften aus komplexen Organisationen physischer Bestandteile entstehen, allerdings auf radikale Weise, so dass das emergente Ergebnis über die physischen Ursachen hinausgeht und nicht a priori aus der rein physischen Natur vorhersehbar oder erklärbar ist. Die Kohärenz solcher emergenter Ansichten wurde in Frage gestellt (Kim 1998), aber sie haben Anhänger (Hasker 1999).
Der neutrale monistische Eigenschaftsdualismus behandelt sowohl bewusste mentale Eigenschaften als auch physische Eigenschaften als in gewisser Weise von einer grundlegenderen Ebene der Realität abhängig und abgeleitet, die an sich weder mental noch physisch ist (Russell 1927, Strawson 1994). Versteht man jedoch unter Dualismus die Behauptung, dass es zwei unterschiedliche Bereiche grundlegender Entitäten oder Eigenschaften gibt, dann sollte der neutrale Monismus vielleicht nicht als eine Version des Eigenschaftsdualismus eingestuft werden, da er weder mentale noch physische Eigenschaften als ultimativ oder grundlegend ansieht.
Der Panpsychismus könnte als eine vierte Art von Eigenschaftsdualismus betrachtet werden, da er davon ausgeht, dass alle Bestandteile der Realität einige psychische oder zumindest proto-psychische Eigenschaften haben, die sich von den physischen Eigenschaften unterscheiden (Nagel 1979). In der Tat könnte der neutrale Monismus konsequent mit einer Version des Panprotopsychismus (Chalmers 1996) kombiniert werden, wonach die proto-mentalen Aspekte von Mikrokonstituenten unter geeigneten Kombinationsbedingungen zu einem vollwertigen Bewusstsein führen können (siehe den Eintrag über Panpsychismus).
Die Natur des relevanten proto-psychischen Aspekts bleibt unklar, und solche Theorien stehen vor einem Dilemma, wenn sie in der Hoffnung angeboten werden, das schwierige Problem zu lösen. Entweder beinhalten die proto-psychischen Eigenschaften die Art von qualitativem phänomenalem Gefühl, das das schwierige Problem hervorruft, oder sie tun es nicht. Wenn ja, dann ist es schwer zu verstehen, wie sie als allgegenwärtige Eigenschaften der Realität auftreten können. Wie könnte ein Elektron oder ein Quark ein solches Erfahrungsgefühl haben? Wenn die proto-psychischen Eigenschaften jedoch kein solches Gefühl beinhalten, ist es nicht klar, wie sie besser als physikalische Eigenschaften in der Lage sind, qualitatives Bewusstsein bei der Lösung des schwierigen Problems zu erklären.
Eine bescheidenere Form des Panpsychismus wurde von dem Neurowissenschaftler Giulio Tononi (2008) vertreten und von anderen Neurowissenschaftlern, darunter Christof Koch (2012), befürwortet. Diese Version leitet sich von Tononis integrierter Informationstheorie (IIT) des Bewusstseins ab, die Bewusstsein mit integrierter Information gleichsetzt, die in vielen Abstufungen existieren kann (siehe Abschnitt 9.6 unten). Nach der IIT besitzt sogar ein einfaches Anzeigegerät wie eine einzelne Fotodiode ein gewisses Maß an integrierter Information und damit ein begrenztes Maß an Bewusstsein, eine Konsequenz, die sowohl Tononi als auch Koch als eine Form des Panpsychismus betrachten.
Für dualistische und andere antiphysikalische Theorien des Bewusstseins wurde eine Vielzahl von Argumenten angeführt. Einige sind weitgehend a priori, wie z. B. jene, die sich auf die angebliche Vorstellbarkeit von Zombies berufen (Kirk 1970, Chalmers 1996), oder Versionen des Wissensarguments (Jackson 1982, 1986), die darauf abzielen, eine antiphysikalische Schlussfolgerung über die Ontologie des Bewusstseins aus den offensichtlichen Grenzen unserer Fähigkeit zu ziehen, die qualitativen Aspekte des bewussten Erlebens durch physikalische Darstellungen der Gehirnprozesse in der dritten Person vollständig zu verstehen. (Siehe Jackson 1998, 2004 für eine gegenteilige Ansicht; siehe auch die Einträge über Zombies und Qualia: das Wissensargument). Andere Argumente für den Dualismus stützen sich auf eher empirische Gründe, wie z. B. solche, die sich auf angebliche kausale Lücken in den physikalischen Kausalketten des Gehirns berufen (Eccles und Popper 1977) oder solche, die auf angeblichen Anomalien in der zeitlichen Abfolge des bewussten Erlebens beruhen (Libet 1982, 1985). Dualistische Argumente beider Arten sind von Physikalisten stark angefochten worden (P.S. Churchland 1981, Dennett und Kinsbourne 1992).
8.2 Physikalistische Theorien
Die meisten anderen metaphysischen Theorien des Bewusstseins sind Versionen des Physikalismus der einen oder anderen bekannten Art.
Eliminativistische Theorien leugnen reduktiv die Existenz des Bewusstseins oder zumindest die Existenz einiger seiner allgemein akzeptierten Arten oder Merkmale (siehe den Eintrag zum eliminativen Materialismus). Die radikalen Eliminativisten lehnen den Begriff des Bewusstseins an sich als verworren oder fehlgeleitet ab und behaupten, dass die Unterscheidung zwischen bewusst und unbewusst die mentale Realität nicht an ihren Schnittstellen trennt (Wilkes 1984, 1988). Sie halten die Idee des Bewusstseins für so verfehlt, dass sie es verdient, eliminiert und durch andere Konzepte und Unterscheidungen ersetzt zu werden, die der wahren Natur des Geistes besser entsprechen (P. S. Churchland 1983).
Die meisten Eliminativisten sind in ihrer ablehnenden Haltung eher zurückhaltend. Sie lehnen den Begriff nicht rundheraus ab, sondern wenden sich nur gegen einige der herausragenden Merkmale, die man ihm gemeinhin zuschreibt, wie Qualia (Dennett 1990, Carruthers 2000), das bewusste Selbst (Dennett 1992) oder das so genannte „kartesische Theater“, bei dem die zeitliche Abfolge bewusster Erfahrungen innerlich projiziert wird (Dennett und Kinsbourne 1992). Bescheidenere Eliminativisten wie Dennett kombinieren ihre qualifizierte Verneinung mit einer positiven Theorie derjenigen Aspekte des Bewusstseins, die sie für real halten, wie z.B. das Modell der multiplen Entwürfe (Abschnitt 9.3 unten).
Die Identitätstheorie, zumindest die strikt psychophysikalische Identitätstheorie, bietet eine weitere stark reduktive Option, indem sie bewusste mentale Eigenschaften, Zustände und Prozesse mit physischen Eigenschaften identifiziert, die meist neuronaler oder neurophysiologischer Natur sind. Wenn eine qualitative bewusste Erfahrung von phänomenalem Rot nur darin besteht, sich in einem Gehirnzustand mit den entsprechenden neurophysiologischen Eigenschaften zu befinden, dann sind solche Erfahrungseigenschaften real, aber ihre Realität ist eine rein physische Realität.
Die Typ-Identitäts-Theorie wird so genannt, weil sie mentale und physische Typen oder Eigenschaften identifiziert, so wie man die Eigenschaft, Wasser zu sein, mit der Eigenschaft, aus H2O-Molekülen zu bestehen, identifiziert. Nach einer kurzen Phase der Popularität in den Anfängen des zeitgenössischen Physikalismus in den 50er und 60er Jahren (Place 1956, Smart 1959) hat sie aufgrund von Problemen wie dem Einwand der multiplen Realisation, demzufolge mentale Eigenschaften abstrakter sind und daher durch viele verschiedene zugrunde liegende strukturelle oder chemische Substrate realisiert werden können (Fodor 1974, Hellman und Thompson 1975), weit an Bedeutung verloren. Wenn ein und dieselbe bewusste Eigenschaft durch verschiedene neurophysiologische (oder sogar nicht-neurophysiologische) Eigenschaften in verschiedenen Organismen realisiert werden kann, dann können die beiden Eigenschaften nicht streng identisch sein.
Nichtsdestotrotz hat die Typ-Identitäts-Theorie in jüngster Zeit eine – wenn auch bescheidene – Wiederauferstehung erfahren, zumindest was Qualia oder qualitative Bewusstseinseigenschaften betrifft. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass die Behandlung der relevanten psychophysischen Verbindung als Identität von einigen als Möglichkeit angesehen wird, das Problem der Erklärungslücke zu lösen (Hill und McLaughlin 1998, Papineau 1995, 2003). Sie argumentieren, dass, wenn die bewusste qualitative Eigenschaft und die neuronale Eigenschaft identisch sind, es nicht notwendig ist zu erklären, wie die letztere die erstere verursacht oder hervorbringt. Sie verursacht sie nicht, sie ist sie. Es gibt also keine Lücke zu schließen, und es bedarf keiner weiteren Erklärung. Identitäten lassen sich nicht erklären, denn nichts ist mit etwas anderem identisch als mit sich selbst, und es hat keinen Sinn zu fragen, warum etwas mit sich selbst identisch ist.
Andere sind jedoch der Meinung, dass die Berufung auf die Identität von Typen nicht so offensichtlich die Notwendigkeit einer Erklärung aufhebt (Levine 2001). Selbst wenn sich zwei Beschreibungen oder Konzepte tatsächlich auf ein und dieselbe Eigenschaft beziehen, kann man vernünftigerweise eine Erklärung für diese Konvergenz erwarten, eine Erklärung dafür, wie sie ein und dieselbe Sache herausgreifen, auch wenn es zunächst oder intuitiv nicht den Anschein hat, dass sie es tun. In anderen Fällen empirisch entdeckter Eigenschaftsidentitäten, wie der von Wärme und kinetischer Energie, gibt es eine Geschichte zu erzählen, die die koreferentielle Konvergenz erklärt, und es scheint fair, dasselbe im psychophysischen Fall zu erwarten. Die Berufung auf Typ-Typ-Identitäten allein reicht also nicht aus, um das Problem der Erklärungslücke zu lösen.
Die meisten physikalischen Theorien des Bewusstseins sind weder eliminativistisch noch basieren sie auf strengen Typusidentitäten. Sie erkennen die Realität des Bewusstseins an, zielen aber darauf ab, es innerhalb der physischen Welt auf der Grundlage einer psycho-physischen Beziehung zu verorten, die nicht auf einer strengen Eigenschaftsidentität beruht.
Zu den gebräuchlichen Varianten gehören solche, die davon ausgehen, dass die bewusste Realität dem Physischen übergeordnet ist, aus dem Physischen besteht oder durch das Physische realisiert wird.
Insbesondere funktionalistische Theorien stützen sich stark auf den Begriff der Verwirklichung, um die Beziehung zwischen dem Bewusstsein und dem Physischen zu erklären. Nach dem Funktionalismus gilt ein Zustand oder Prozess aufgrund der funktionalen Rolle, die er innerhalb eines entsprechend organisierten Systems spielt, als zu einem bestimmten mentalen oder bewussten Typ gehörig (Block 1980a). Ein gegebener physischer Zustand verwirklicht den entsprechenden bewussten mentalen Typ, indem er die entsprechende Rolle innerhalb des größeren physischen Systems spielt, in dem er enthalten ist (siehe den Eintrag über Funktionalismus). Der Funktionalist beruft sich oft auf Analogien zu anderen Beziehungen zwischen den Ebenen, wie zwischen der biologischen und der biochemischen oder der chemischen und der atomaren Ebene. In jedem Fall werden Eigenschaften oder Fakten auf einer Ebene durch komplexe Wechselwirkungen zwischen Elementen auf einer darunter liegenden Ebene realisiert.
Die Kritiker des Funktionalismus bestreiten häufig, dass das Bewusstsein in funktionalen Begriffen angemessen erklärt werden kann (Block 1980a, 1980b, Levine 1983, Chalmers 1996). Solchen Kritikern zufolge mag das Bewusstsein interessante funktionale Eigenschaften haben, aber es ist nicht wesentlich funktional. Solche Behauptungen werden manchmal mit dem Verweis auf die angebliche Möglichkeit abwesender oder umgekehrter Qualia untermauert, d. h. die Möglichkeit von Wesen, die funktional dem normalen Menschen entsprechen, aber umgekehrte oder gar keine Qualia haben. Der Status solcher Möglichkeiten ist umstritten (Shoemaker 1981, Dennett 1990, Carruthers 2000), aber wenn sie akzeptiert werden, scheinen sie ein Problem für den Funktionalisten darzustellen (siehe den Eintrag über Qualia).
Diejenigen, die den ontologischen Physikalismus auf die Realisierungsrelation gründen, kombinieren ihn oft mit einer nicht-reduktiven Sichtweise auf der begrifflichen oder repräsentativen Ebene, die die Autonomie der speziellen Wissenschaften und die unterschiedlichen Beschreibungsmodi und kognitiven Zugänge, die sie bieten, betont.
Ein nicht-reduktiver Physikalismus dieser Art bestreitet, dass die theoretischen und begrifflichen Ressourcen, die für den Umgang mit Fakten auf der Ebene des zugrunde liegenden Substrats oder der Realisierungsebene angemessen und ausreichend sind, auch für den Umgang mit jenen auf der Realisierungsebene angemessen sein müssen (Putnam 1975, Boyd 1980). Wie bereits in der Antwort auf die Frage nach dem „Wie“ erwähnt, kann man glauben, dass alle wirtschaftlichen Fakten physikalisch realisiert sind, ohne zu glauben, dass die Ressourcen der Naturwissenschaften alle kognitiven und konzeptionellen Werkzeuge bereitstellen, die wir für die Wirtschaftswissenschaften benötigen (Fodor 1974).
Der nicht-reduktive Physikalismus ist in Frage gestellt worden, weil er es angeblich versäumt hat, seine „physikalistische Schuldigkeit“ in reduktiver Münze zu tun. Ihm wird vorgeworfen, dass er angeblich keine angemessene Erklärung dafür liefert, wie bewusste Eigenschaften durch zugrunde liegende neuronale, physikalische oder funktionale Strukturen oder Prozesse realisiert werden oder werden könnten (Kim 1987, 1998). In der Tat wurde ihm Inkohärenz vorgeworfen, weil er versucht, die Behauptung einer physischen Realisierung mit der Verweigerung der Fähigkeit zu kombinieren, diese Beziehung in einer strikten und a priori verständlichen Weise zu buchstabieren (Jackson 2004).
Wie oben in der Diskussion über die Wie-Frage erwähnt, antworten die nicht-reduktiven Physikalisten jedoch, indem sie zustimmen, dass eine Erklärung der psycho-physischen Erkenntnis in der Tat notwendig ist, aber hinzufügen, dass die relevante Erklärung weit hinter der apriorischen Ableitbarkeit zurückbleiben kann, aber dennoch ausreicht, um unsere legitimen Erklärungsanforderungen zu erfüllen (McGinn 1991, Van Gulick 1985). Diese Frage bleibt umstritten.
9. Spezifische Theorien des Bewusstseins
Obwohl es viele allgemeine metaphysische/ontologische Theorien des Bewusstseins gibt, ist die Liste der spezifischen, detaillierten Theorien über seine Natur noch länger und vielfältiger. Kein kurzer Überblick könnte auch nur annähernd umfassend sein, aber sieben Haupttypen von Theorien können helfen, die grundlegende Bandbreite der Möglichkeiten aufzuzeigen: Theorien höherer Ordnung, Repräsentationstheorien, interpretative narrative Theorien, kognitive Theorien, neuronale Theorien, Quantentheorien und nichtphysikalische Theorien. Die Kategorien schließen sich nicht gegenseitig aus; so gehen beispielsweise viele kognitive Theorien auch von einem neuronalen Substrat für die betreffenden kognitiven Prozesse aus. Nichtsdestotrotz bietet die Einteilung in die sieben Klassen einen grundlegenden Überblick.
9.1 Theorien höherer Ordnung
Theorien höherer Ordnung (HO) analysieren den Begriff des bewussten mentalen Zustands im Sinne einer reflexiven meta-mentalen Selbstwahrnehmung. Der Kerngedanke ist, dass ein mentaler Zustand M nur dann ein bewusster mentaler Zustand ist, wenn er von einem gleichzeitigen und nicht-inferentiellen Zustand höherer Ordnung (d. h. meta-mental) begleitet wird, dessen Inhalt darin besteht, dass man sich jetzt in M befindet. Unbewusste mentale Zustände sind gerade deshalb unbewusst, weil uns die relevanten Zustände höherer Ordnung über sie fehlen. Ihr Unbewusst-Sein besteht darin, dass wir uns nicht reflexiv und direkt bewusst sind, dass wir uns in ihnen befinden (siehe den Eintrag über Theorien höherer Ordnung des Bewusstseins).
Theorien höherer Ordnung gibt es in zwei Hauptvarianten, die sich hinsichtlich des psychologischen Modus der relevanten bewusstseinsbildenden meta-mentalen Zustände unterscheiden. Die Theorien des Denkens höherer Ordnung (HOT) gehen davon aus, dass der erforderliche Zustand höherer Ordnung ein assertorischer, gedankenähnlicher Metazustand ist (Rosenthal 1986, 1993). Die Theorien der Wahrnehmung höherer Ordnung (HOP) gehen davon aus, dass es sich um einen wahrnehmungsähnlichen Zustand handelt, der mit einer Art innerem Sinn und intramentalen Überwachungssystemen verbunden ist (Armstrong 1981, Lycan 1987, 1996).
Jede hat ihre relativen Stärken und Probleme. HOT-Theoretiker stellen fest, dass wir keine inneren Sinnesorgane haben und behaupten, dass wir keine anderen Sinnesqualitäten erleben als die, die uns durch die nach außen gerichtete Wahrnehmung präsentiert werden. HOP-Theoretiker hingegen können argumentieren, dass ihre Sichtweise einige der zusätzlichen Bedingungen, die von HO-Darstellungen gefordert werden, als natürliche Konsequenzen der wahrnehmungsähnlichen Natur der relevanten Zustände höherer Ordnung erklärt. Insbesondere die Forderung, dass der bewusstseinsbildende Meta-Zustand nicht inferentiell und simultan mit seinem mentalen Objekt auf niedrigerer Ebene sein muss, könnte durch die parallelen Bedingungen erklärt werden, die typischerweise für die Wahrnehmung gelten. Wir nehmen wahr, was jetzt geschieht, und zwar auf eine Weise, die keine Inferenzen beinhaltet, zumindest keine expliziten Inferenzen auf der persönlichen Ebene. Diese Bedingungen sind in der HOT-Sichtweise nicht weniger notwendig, bleiben aber unerklärt, was dem HOP-Modell einen gewissen Erklärungsvorteil zu geben scheint (Lycan 2004, Van Gulick 2000), obwohl einige HOT-Theoretiker anders argumentieren (Carruthers 2000).
Unabhängig von ihren jeweiligen Vorzügen stehen sowohl die HOP- als auch die HOT-Theorien vor einigen gemeinsamen Herausforderungen, darunter dem so genannten Generalitätsproblem. Ein Gedanke oder eine Wahrnehmung eines bestimmten Gegenstands X – sei es ein Stein, ein Stift oder eine Kartoffel – macht X im Allgemeinen nicht zu einem bewussten X. Wenn man die Kartoffel auf der Theke sieht oder an sie denkt, wird sie nicht zu einer bewussten Kartoffel. Warum also sollte der Gedanke oder die Wahrnehmung eines bestimmten Wunsches oder einer Erinnerung diese zu einem bewussten Wunsch oder einer bewussten Erinnerung machen (Dretske 1995, Byrne 1997). Es reicht auch nicht aus, darauf hinzuweisen, dass wir den Begriff „bewusst“ nicht auf Steine oder Stifte anwenden, die wir wahrnehmen oder an die wir denken, sondern nur auf mentale Zustände, die wir wahrnehmen oder an die wir denken (Lycan 1997, Rosenthal 1997). Das mag richtig sein, aber wir brauchen eine Erklärung, warum dies angemessen ist.
Die Sichtweise der höheren Ordnung ist am offensichtlichsten für die meta-mentalen Formen des Bewusstseins relevant, aber einige ihrer Befürworter gehen davon aus, dass sie auch andere Arten des Bewusstseins erklären kann, einschließlich der eher subjektiven „Was es ist“ und qualitativen Arten. Eine gängige Strategie besteht darin, Qualia als mentale Merkmale zu analysieren, die unbewusst auftreten können; sie könnten beispielsweise als Eigenschaften innerer Zustände erklärt werden, deren strukturierte Ähnlichkeitsbeziehungen zu Überzeugungen über objektive Ähnlichkeiten in der Welt führen (Shoemaker 1975, 1990). Obwohl unbewusste Qualia diese funktionale Rolle spielen können, muss es nicht so sein, dass man sich in einem Zustand befindet, in dem sie vorhanden sind (Nelkin 1989, Rosenthal 1991, 1997). Dem HO-Theoretiker zufolge tritt die Ähnlichkeit mit dem, was es ist, erst dann ein, wenn wir uns dieses Zustands erster Ordnung und seiner qualitativen Eigenschaften bewusst werden, indem wir einen geeigneten Meta-Zustand haben, der auf ihn gerichtet ist.
Kritiker der HO-Ansicht haben diese Darstellung bestritten, und einige haben argumentiert, dass der Begriff der unbewussten Qualia, auf dem sie beruht, inkohärent ist (Papineau 2002). Unabhängig davon, ob solche vorgeschlagenen HO-Darstellungen von Qualia erfolgreich sind oder nicht, ist es wichtig festzuhalten, dass die meisten HO-Befürworter davon ausgehen, dass sie eine umfassende Theorie des Bewusstseins anbieten, oder zumindest den Kern einer solchen allgemeinen Theorie, und nicht nur eine, die sich auf einige spezielle meta-mentale Formen des Bewusstseins beschränkt.
Andere Varianten der HO-Theorie gehen über die Standardversionen HOT und HOP hinaus, darunter auch solche, die das Bewusstsein eher im Sinne von dispositionellen als von ablaufenden Gedanken höherer Ordnung analysieren (Carruthers 2000). Andere appellieren eher an ein implizites als an ein explizites Verständnis höherer Ordnung und schwächen oder entfernen die Standardannahme, dass der Meta-Zustand von seinem Objekt niedrigerer Ordnung unterscheidbar und getrennt sein muss (Gennaro 1995, Van Gulick 2000, 2004), wobei sich solche Ansichten mit den so genannten reflexiven Theorien überschneiden, die in diesem Abschnitt erörtert werden. Andere Varianten der HO-Theorie werden weiterhin angeboten, und die Debatte zwischen Befürwortern und Kritikern des grundlegenden Ansatzes bleibt aktiv (siehe die jüngsten Beiträge in Gennaro 2004.)
9.2 Reflexive Theorien
Reflexive Theorien, wie auch Theorien höherer Ordnung, implizieren eine enge Verbindung zwischen Bewusstsein und Selbstwahrnehmung. Sie unterscheiden sich dadurch, dass sie den Aspekt des Selbstbewusstseins direkt im Bewusstseinszustand selbst verorten und nicht in einem bestimmten Meta-Zustand, der auf ihn gerichtet ist. Die Idee, dass bewusste Zustände eine doppelte Intentionalität beinhalten, geht mindestens auf Brentano (1874) im 19. Jahrhundert zurück. Der Bewusstseinszustand ist absichtlich auf ein Objekt außerhalb seiner selbst gerichtet – etwa einen Baum oder einen Stuhl im Falle einer bewussten Wahrnehmung – und gleichzeitig absichtlich auf sich selbst gerichtet. Ein und derselbe Zustand ist sowohl ein nach außen gerichtetes Bewusstsein als auch ein Bewusstsein von sich selbst. Mehrere neuere Theorien behaupten, dass ein solches reflexives Bewusstsein ein zentrales Merkmal bewusster mentaler Zustände ist. Einige verstehen sich als Varianten der Theorie höherer Ordnung (Gennaro 2004, 2012), während andere die Kategorie der höheren Ordnung ablehnen und ihre Theorien als eine Darstellung des Bewusstseins als Selbstbewusstsein „gleicher Ordnung“ beschreiben (Kriegel 2009). Wieder andere stellen die Ebenenunterscheidung in Frage, indem sie den meta-intentionalen Inhalt als implizit im phänomenalen Inhalt bewusster Zustände erster Ordnung analysieren, wie in den so genannten „Higher-Order Global State“-Modellen (HOGS) (Van Gulick 2004, 2006). Eine Auswahl von Beiträgen, von denen einige die reflexive Sichtweise unterstützen und einige sie angreifen, findet sich in Krigel und Williford (2006).
9.3 Repräsentationalistische Theorien
Fast alle Theorien des Bewusstseins gehen davon aus, dass es repräsentationale Eigenschaften hat, aber die so genannten repräsentationalistischen Theorien sind durch die stärkere Ansicht geprägt, dass seine repräsentationalen Eigenschaften seine mentalen Eigenschaften erschöpfen (Harman 1990, Tye 1995, 2000). Nach Ansicht der Repräsentationstheoretiker haben bewusste mentale Zustände keine anderen mentalen Eigenschaften als ihre repräsentationalen Eigenschaften. Daher unterscheiden sich zwei bewusste oder erfahrungsbezogene Zustände, die alle ihre repräsentationalen Eigenschaften gemeinsam haben, in keiner mentalen Hinsicht.
Die genaue Aussagekraft der Behauptung hängt davon ab, wie man den Begriff der „gegenständlichen Gleichheit“ interpretiert, für den es viele plausible alternative Kriterien gibt. Man könnte ihn grob im Sinne von Zufriedenheits- oder Wahrheitsbedingungen definieren, aber so verstanden scheint die repräsentationalistische These eindeutig falsch zu sein. Es gibt zu viele Möglichkeiten, wie Zustände ihre Zufriedenheits- oder Wahrheitsbedingungen teilen und sich dennoch mental unterscheiden können, einschließlich derer, die die Art und Weise betreffen, wie sie diese Bedingungen konzeptualisieren oder präsentieren.
Im entgegengesetzten Extremfall könnte man zwei Zustände als repräsentationsmäßig verschieden betrachten, wenn sie sich in allen Merkmalen unterscheiden, die für ihre Repräsentationsfunktion oder -operation eine Rolle spielen. Bei einer solchen liberalen Lesart würden alle Unterschiede in den Trägern von Inhalten als repräsentationale Unterschiede gelten, selbst wenn sie denselben intentionalen oder repräsentationalen Inhalt hätten; sie könnten sich nur in ihren Mitteln oder ihrer Darstellungsweise unterscheiden, nicht aber in ihrem Inhalt.
Eine solche Lesart würde natürlich die Plausibilität der Behauptung erhöhen, dass die Repräsentationseigenschaften eines Bewusstseinszustandes seine mentalen Eigenschaften erschöpfen, aber um den Preis einer erheblichen Schwächung oder gar Trivialisierung der These. Daher scheint der Repräsentationstheoretiker eine Interpretation der Repräsentationsgleichheit zu benötigen, die über bloße Erfüllungsbedingungen hinausgeht und alle intentionalen oder inhaltlichen Aspekte der Repräsentation widerspiegelt, ohne auf bloße Unterschiede in den zugrundeliegenden nicht-inhaltlichen Merkmalen der Prozesse auf der Realisierungsebene zu achten. Die meisten Repräsentationstheoretiker stellen daher Bedingungen für bewusste Erfahrung auf, die sowohl eine inhaltliche Bedingung als auch einige weitere kausale Rollen- oder Formatanforderungen beinhalten (Tye 1995, Dretske 1995, Carruthers 2000). Andere Repräsentationalisten akzeptieren die Existenz von Qualia, behandeln sie aber als objektive Eigenschaften, die externen Objekten zugeschrieben werden, d.h. sie behandeln sie als repräsentierte Eigenschaften und nicht als Eigenschaften von Repräsentationen oder mentalen Zuständen (Dretske 1995, Lycan 1996).
Der Repräsentationalismus kann insofern als eine qualifizierte Form des Eliminativismus verstanden werden, als er die Existenz von Eigenschaften bestreitet, die bewusste mentale Zustände nach allgemeiner Auffassung haben – oder zumindest zu haben scheinen -, nämlich solche, die mental, aber nicht repräsentativ sind. Qualia, zumindest wenn sie als intrinsische monadische Eigenschaften bewusster Zustände verstanden werden, die der Introspektion zugänglich sind, scheinen die offensichtlichsten Ziele für eine solche Eliminierung zu sein. In der Tat besteht ein Teil der Motivation für den Repräsentationalismus darin, zu zeigen, dass man alle Fakten über das Bewusstsein unterbringen kann, vielleicht innerhalb eines physikalistischen Rahmens, ohne Platz für Qualia oder andere scheinbar nicht-repräsentationale mentale Eigenschaften finden zu müssen (Dennett 1990, Lycan 1996, Carruthers 2000).
Der Repräsentationalismus war in den letzten Jahren recht populär und hatte viele Befürworter, aber er ist nach wie vor höchst umstritten, und die Intuitionen über Schlüsselfälle und Gedankenexperimente widersprechen sich (Block 1996). Insbesondere die Möglichkeit der umgekehrten Qualia stellt einen entscheidenden Testfall dar. Für Anti-Repräsentationalisten zeigt die bloße logische Möglichkeit umgekehrter Qualia, dass sich Bewusstseinszustände in einer bedeutenden mentalen Hinsicht unterscheiden können, während sie repräsentational übereinstimmen. Repräsentationstheoretiker leugnen entweder die Möglichkeit einer solchen Inversion oder deren angebliche Bedeutung (Dretske 1995, Tye 2000).
Viele andere Argumente sind für und gegen den Repräsentationalismus vorgebracht worden, wie z.B. diejenigen, die sich auf die Wahrnehmung ein und desselben Sachverhalts in verschiedenen Sinnesmodalitäten beziehen – das Sehen und Fühlen desselben Würfels -, was mentale Unterschiede zu beinhalten scheint, die sich davon unterscheiden, wie die betreffenden Zustände die Welt repräsentieren (Peacocke 1983, Tye 2003). In jedem Fall können beide Seiten mit starken Intuitionen und argumentativem Einfallsreichtum aufwarten. Die lebhafte Debatte geht weiter.
9.4 Narrative Deutungstheorien
Einige Theorien des Bewusstseins betonen den interpretativen Charakter von Fakten über das Bewusstsein. Solchen Ansichten zufolge ist das, was bewusst ist oder nicht, nicht immer eine eindeutige Tatsache oder zumindest nicht so unabhängig von einem größeren Kontext interpretativer Urteile. Das bekannteste philosophische Beispiel ist das „Multiple Drafts Model“ (MDM) des Bewusstseins, das von Daniel Dennett (1991) vertreten wird. Es kombiniert Elemente sowohl des Repräsentationalismus als auch der Theorie höherer Ordnung, aber auf eine Weise, die sich auf interessante Weise von den Standardversionen der beiden Modelle unterscheidet und eine stärker interpretierende und weniger stark realistische Sicht des Bewusstseins bietet.
Das MDM umfasst viele unterschiedliche, aber miteinander verknüpfte Merkmale. Sein Name spiegelt die Tatsache wider, dass zu jedem Zeitpunkt im gesamten Gehirn viele verschiedene Inhalte fixiert werden. Was einige dieser Inhalte bewusst macht, ist nicht, dass sie an einem privilegierten räumlichen oder funktionellen Ort – dem so genannten „kartesischen Theater“ – oder in einem besonderen Modus oder Format auftreten, was das MDM alles verneint. Vielmehr geht es um das, was Dennett als „zerebrale Berühmtheit“ [„Cerebral Celebrity“, Anm. d. Übersetzers] bezeichnet, d. h. um das Ausmaß, in dem ein bestimmter Inhalt die künftige Entwicklung anderer Inhalte im gesamten Gehirn beeinflusst, insbesondere im Hinblick darauf, wie sich diese Auswirkungen in den Berichten und Verhaltensweisen manifestieren, die die Person als Reaktion auf verschiedene Sonden macht, die auf ihren bewussten Zustand hinweisen könnten. Eine der Hauptaussagen der MDM ist, dass verschiedene Tests (z. B. verschiedene Fragen oder verschiedene Kontexte, die unterschiedliche Verhaltensanforderungen stellen) unterschiedliche Antworten über den Bewusstseinszustand der Person hervorrufen können. Darüber hinaus kann es nach der MDM keine sondenunabhängige Aussage darüber geben, wie der Bewusstseinszustand der Person wirklich war. Daher das „Multiple“ des Multiple-Drafts-Modells.
Das MDM ist insofern repräsentationalistisch, als es das Bewusstsein in Form von Inhaltsbeziehungen analysiert. Es verneint auch die Existenz von Qualia und lehnt daher jeden Versuch ab, bewusste Zustände von unbewussten Zuständen durch deren Vorhandensein zu unterscheiden. Es lehnt auch die Vorstellung vom Selbst als innerem Beobachter ab, unabhängig davon, ob es sich im kartesianischen Theater oder anderswo befindet. Das MDM behandelt das Selbst als einen emergenten oder virtuellen Aspekt der kohärenten, grob seriellen Erzählung, die durch das interaktive Spiel der Inhalte im System konstruiert wird. Viele dieser Inhalte sind auf der intentionalen Ebene als Wahrnehmungen oder Fixierungen von einem relativ einheitlichen und zeitlich ausgedehnten Standpunkt aus miteinander verbunden, d.h. sie sind inhaltlich kohärent, als wären sie die Erfahrungen eines fortlaufenden Selbst. Entscheidend für die MDM-Darstellung ist jedoch die Reihenfolge der Abhängigkeiten. Die relevanten Inhalte sind nicht deshalb vereinheitlicht, weil sie alle von einem einzigen Selbst beobachtet werden, sondern genau das Gegenteil. Gerade weil sie auf der Ebene des Inhalts einheitlich und kohärent sind, gelten sie als Erfahrungen eines einzigen Selbst, zumindest eines einzigen virtuellen Selbst.
In dieser Hinsicht hat das MDM einige Elemente mit Theorien höherer Ordnung gemeinsam. Die Inhalte, aus denen sich die serielle Erzählung zusammensetzt, sind zumindest implizit die eines fortwährenden, wenn auch virtuellen Selbst, und sie sind es, die am ehesten in den Berichten zum Ausdruck kommen, die die Person als Reaktion auf verschiedene Sonden über ihren Bewusstseinszustand macht. Sie beinhalten also ein gewisses Maß an Reflexivität oder Selbstbewusstsein, wie es für Theorien höherer Ordnung von zentraler Bedeutung ist, aber der Aspekt höherer Ordnung ist eher ein implizites Merkmal des Inhaltsstroms und nicht in ausgeprägten expliziten Zuständen höherer Ordnung vorhanden, wie sie in den Standard-HO-Theorien zu finden sind.
Dennetts MDM war sehr einflussreich, hat aber auch Kritik auf sich gezogen, insbesondere von denjenigen, die seine Sicht des Bewusstseins für nicht ausreichend realistisch halten und bestenfalls unvollständig, was das erklärte Ziel angeht, das Bewusstsein vollständig zu erklären. (Block 1994, Dretske 1994, Levine 1994). Viele seiner Kritiker erkennen die Einsicht und den Wert des MDM an, bestreiten aber, dass es keine anderen realen Fakten des Bewusstseins gibt als die, die von ihm erfasst werden (Rosenthal 1994, Van Gulick 1994, Akins 1996).
Aus einer eher empirischen Perspektive hat der Neurowissenschaftler Michael Gazzaniga (2011) die Idee eines in der linken Hemisphäre angesiedelten „Dolmetschermoduls“ vorgestellt, das unseren Handlungen einen Sinn verleiht und eine fortlaufende Erzählung über unsere Handlungen und Erfahrungen konstruiert. Obwohl diese Theorie nicht als vollständige Theorie des Bewusstseins gedacht ist, wird einer solchen interpretativen, narrativen Aktivität eine wichtige Rolle zugewiesen.
9.5 Kognitive Theorien
Eine Reihe von Theorien des Bewusstseins verbinden es mit einer bestimmten kognitiven Architektur oder mit einem besonderen Aktivitätsmuster, das mit dieser Struktur zusammenhängt.
Globaler Arbeitsraum. Ein wichtiges psychologisches Beispiel für den kognitiven Ansatz ist die Theorie des globalen Arbeitsraums. Die ursprünglich von Bernard Baars (1988) entwickelte Global-Workspace-Theorie beschreibt das Bewusstsein als einen Wettbewerb zwischen Prozessoren und Outputs um eine Ressource mit begrenzter Kapazität, die Informationen für den allgemeinen Zugriff und die Nutzung „sendet“. Die Tatsache, dass sie auf diese Weise dem globalen Arbeitsraum zur Verfügung steht, macht die Information zumindest im Sinne des Zugangs bewusst. Sie steht für Berichte und die flexible Steuerung des Verhaltens zur Verfügung. Ähnlich wie Dennetts „zerebrale Berühmtheit“ macht die Ausstrahlung im Arbeitsbereich Inhalte zugänglicher und einflussreicher in Bezug auf andere Inhalte und andere Prozessoren. Gleichzeitig wird der ursprüngliche Inhalt durch die wiederkehrende Unterstützung aus dem Arbeitsbereich und von anderen Inhalten, mit denen er zusammenhängt, gestärkt. Die Kapazitätsgrenzen des Arbeitsraums entsprechen den Grenzen, die in vielen kognitiven Modellen der fokalen Aufmerksamkeit oder dem Arbeitsgedächtnis gesetzt werden.
Das Modell wurde von Stanislas Dehaene und anderen (2000) mit vorgeschlagenen Verbindungen zu bestimmten neuronalen und funktionellen Gehirnsystemen weiterentwickelt. Von besonderer Bedeutung ist die Behauptung, dass Bewusstsein sowohl im Zugangs- als auch im phänomenalen Sinne dann und nur dann auftritt, wenn der relevante Inhalt in das größere globale Netzwerk eintritt, das sowohl primäre sensorische Bereiche als auch viele andere Bereiche, einschließlich der mit der Aufmerksamkeit verbundenen frontalen und parietalen Bereiche, umfasst. Dehaene behauptet, dass die bewusste Wahrnehmung erst mit der „Zündung“ dieses größeren globalen Netzwerks beginnt; die Aktivität in den primären Sinnesbereichen reicht nicht aus, egal wie intensiv oder wiederkehrend sie ist (siehe jedoch die gegenteilige Ansicht von Victor Lamme in Abschnitt 9.7).
Attended Intermediate Representation. Eine weitere kognitive Theorie ist Jesse Prinz‘ (2012) „Attended Intermediate Level Representation Theory“ (AIR). Bei dieser Theorie handelt es sich um eine neurokognitive Hybriddarstellung des Bewusstseins. Nach der AIR-Theorie muss eine bewusste Wahrnehmung sowohl kognitive als auch neuronale Bedingungen erfüllen. Es muss sich um eine Repräsentation einer wahrnehmungsbezogenen Zwischenebene handeln, die nach Prinz die einzigen Eigenschaften sind, deren wir uns in der bewussten Erfahrung bewusst sind – wir nehmen nur grundlegende Merkmale externer Objekte wie Farben, Formen, Töne und Gefühle wahr. Prinz zufolge ist unser Bewusstsein für Eigenschaften auf höherer Ebene – wie zum Beispiel, dass es sich um einen Tannenbaum oder meine Autoschlüssel handelt – ausschließlich eine Sache der Beurteilung und nicht der bewussten Erfahrung. Daraus ergibt sich der intermediär-repräsentative (IR) Aspekt von AIR. Um bewusst zu sein, muss ein solcher repräsentierter Inhalt auch beachtet werden (der A-Aspekt von AIR). Prinz schlägt für jede Komponente ein bestimmtes neuronales Substrat vor. Er identifiziert die intermediären Repräsentationen mit Gamma-Vektoraktivität (40-80 Hz) im sensorischen Kortex und die Aufmerksamkeitskomponente mit synchronisierten Oszillationen, die diese Gamma-Vektoraktivität einbeziehen können.
9.6 Theorie der Informationsintegration
Die Integration von Informationen aus vielen Quellen ist ein wichtiges Merkmal des Bewusstseins und wird, wie bereits erwähnt (Abschnitt 6.4), häufig als eine seiner Hauptfunktionen genannt. Die Integration von Inhalten spielt in verschiedenen Theorien eine wichtige Rolle, insbesondere in der globalen Arbeitsraumtheorie (Abschnitt 9.3). Ein Vorschlag des Neurowissenschaftlers Giulio Tononi (2008) geht jedoch noch weiter, indem er Bewusstsein mit integrierter Information identifiziert und behauptet, dass eine Informationsintegration der relevanten Art sowohl notwendig als auch hinreichend für das Bewusstsein ist, unabhängig von dem Substrat, in dem es realisiert wird (das nicht neural oder biologisch sein muss). Nach Tononis integrierter Informationstheorie (IIT) ist das Bewusstsein eine rein informationstheoretische Eigenschaft von Systemen. Er schlägt ein mathematisches Maß φ vor, das darauf abzielt, nicht nur die Information in den Teilen eines gegebenen Systems zu messen, sondern auch die in der Organisation des Systems enthaltene Information, die über die in seinen Teilen enthaltene Information hinausgeht. φ entspricht somit dem Grad der informationellen Integration des Systems. Ein solches System kann viele sich überschneidende Komplexe enthalten, und der Komplex mit dem höchsten φ-Wert wird nach der IIT bewusst sein.
Nach der IIT ist das Bewusstsein quantitativ unterschiedlich stark ausgeprägt und weist viele Grade auf, die den φ-Werten entsprechen. So wird selbst ein einfaches System wie eine einzelne Fotodiode bis zu einem gewissen Grad bewusst sein, wenn es nicht in einem größeren Komplex enthalten ist. In diesem Sinne impliziert die IIT eine Form des Panpsychismus, den Tononi ausdrücklich befürwortet. Nach der IIT wird die Qualität des jeweiligen Bewusstseins durch die Gesamtheit der Informationsbeziehungen innerhalb des jeweiligen integrierten Komplexes bestimmt. Die IIT zielt also darauf ab, sowohl die Quantität als auch die Qualität des phänomenalen Bewusstseins zu erklären. Andere Neurowissenschaftler, insbesondere Christof Koch, haben den IIT-Ansatz ebenfalls befürwortet (Koch 2012).
9.7 Neuronale Theorien
Neuronale Theorien des Bewusstseins gibt es in vielen Formen, aber die meisten betreffen in irgendeiner Weise die so genannten „neuronalen Korrelate des Bewusstseins“ oder NCCs. Sofern man kein Dualist oder sonstiger Nicht-Physikalist ist, ist mehr als nur Korrelation erforderlich; zumindest einige NCCs müssen die wesentlichen Substrate des Bewusstseins sein. Eine erklärende neuronale Theorie muss erklären, warum oder wie die relevanten Korrelationen existieren, und wenn die Theorie dem Physikalismus verpflichtet ist, muss sie zeigen, wie die zugrundeliegenden neuronalen Substrate mit ihren neuronalen Korrelaten identisch sein könnten oder sie zumindest verwirklichen, indem sie die erforderlichen Rollen oder Bedingungen erfüllen (Metzinger 2000).
Solche Theorien unterscheiden sich nicht nur in den neuronalen Prozessen oder Eigenschaften, auf die sie sich berufen, sondern auch in den Aspekten des Bewusstseins, die sie als ihre jeweiligen Erklärungen annehmen. Einige basieren auf übergeordneten systemischen Merkmalen des Gehirns, während andere sich auf spezifischere physiologische oder strukturelle Eigenschaften konzentrieren, mit entsprechenden Unterschieden in ihren beabsichtigten Erklärungszielen. Die meisten zielen in irgendeiner Weise darauf ab, eine Verbindung zu Theorien des Bewusstseins auf anderen Beschreibungsebenen herzustellen, wie z. B. zu kognitiven, repräsentationalen oder Theorien höherer Ordnung.
Eine Auswahl neuerer neuronaler Theorien könnte Modelle umfassen, die sich auf globale integrierte Felder (Kinsbourne), Bindung durch synchrone Oszillation (Singer 1999, Crick und Koch 1990), NMDA-vermittelte transiente neuronale Assemblies (Flohr 1995), thalamisch modulierte Muster kortikaler Aktivierung (Llinas 2001), reentrante kortikale Schleifen (Edelman 1989) berufen, Komparatormechanismen, die in kontinuierliche Handlungsvorhersage-Bewertungsschleifen zwischen Frontal- und Mittelhirnarealen eingebunden sind (Gray 1995), auf der linken Hemisphäre basierende Interpretationsprozesse (Gazzaniga 1988) und emotionale somatosensorische hämostatische Prozesse, die im frontal-limbischen Nexus (Damasio 1999) oder im periaqueduktalen Grau (Panksepp 1998) angesiedelt sind.
In jedem Fall geht es darum zu erklären, wie Organisation und Aktivität auf der entsprechenden neuronalen Ebene dem einen oder anderen Haupttyp oder Merkmal des Bewusstseins zugrunde liegen könnten. Globale Felder oder vorübergehende synchrone Ansammlungen könnten der intentionalen Einheit des phänomenalen Bewusstseins zugrunde liegen. NMDA-basierte Plastizität, spezifische thalamische Projektionen in den Kortex oder regelmäßige oszillatorische Wellen könnten zur Bildung kurzfristiger, aber weit verbreiteter neuronaler Muster oder Regelmäßigkeiten beitragen, die erforderlich sind, um aus der lokalen Aktivität in verschiedenen spezialisierten Gehirnmodulen eine integrierte bewusste Erfahrung zu stricken. Die Interpretationsprozesse der linken Hemisphäre könnten die Grundlage für narrative Formen der bewussten Selbstwahrnehmung bilden. Es ist also möglich, dass mehrere unterschiedliche neuronale Theorien zutreffen, wobei jede von ihnen einen Teil des Verständnisses der Verbindungen zwischen bewusster Mentalität in ihren verschiedenen Formen und dem aktiven Gehirn auf seinen vielen Ebenen komplexer Organisation und Struktur beiträgt.
Eine besondere Kontroverse in jüngster Zeit betrifft die Frage, ob globale oder lediglich lokale rekurrente Aktivität für phänomenales Bewusstsein ausreichend ist. Die Befürworter des Modells des globalen neuronalen Arbeitsbereichs (Dehaene 2000) haben argumentiert, dass Bewusstsein jeglicher Art nur dann auftreten kann, wenn die Inhalte mit einem groß angelegten Muster wiederkehrender Aktivität aktiviert werden, an der sowohl frontale und parietale Bereiche als auch primäre sensorische Bereiche des Kortex beteiligt sind. Andere, insbesondere der Psychologe Victor Lamme (2006) und der Philosoph Ned Block (2007), haben argumentiert, dass lokale rekurrente Aktivität zwischen höheren und niedrigeren Bereichen innerhalb des sensorischen Kortex (z. B. mit dem visuellen Kortex) für phänomenales Bewusstsein ausreichen kann, selbst wenn verbale Berichtbarkeit und andere Indikatoren für den Zugang zum Bewusstsein fehlen.
9.8 Quantentheorien
Andere physikalische Theorien gehen über die neuronale Ebene hinaus und verorten den natürlichen Ort des Bewusstseins auf einer viel fundamentaleren Ebene, insbesondere auf der mikrophysikalischen Ebene der Quantenphänomene. Nach diesen Theorien können die Natur und die Grundlagen des Bewusstseins im Rahmen der klassischen Physik nicht angemessen verstanden werden, sondern müssen in dem alternativen Bild der physikalischen Realität gesucht werden, das die Quantenmechanik bietet. Die Befürworter des Quantenbewusstseins-Ansatzes sehen in der radikal alternativen und oft kontraintuitiven Natur der Quantenphysik genau das, was nötig ist, um die angeblichen Erklärungshindernisse zu überwinden, denen sich herkömmlichere Versuche, die psychophysische Kluft zu überbrücken, gegenübersehen.
Auch hier gibt es eine Vielzahl spezifischer Theorien und Modelle, die unter Berufung auf eine Vielzahl von Quantenphänomenen vorgeschlagen wurden, um eine Vielzahl von Merkmalen des Bewusstseins zu erklären. Es wäre unmöglich, sie hier zu katalogisieren oder auch nur die wichtigsten Merkmale der Quantenmechanik, auf die sie sich berufen, in irgendeiner Weise zu erklären. Ein kurzer, selektiver Überblick kann jedoch einen – wenn auch unvollständigen und unklaren – Eindruck von den vorgeschlagenen Optionen vermitteln.
Der Physiker Roger Penrose (1989, 1994) und der Anästhesist Stuart Hameroff (1998) haben sich für ein Modell eingesetzt, nach dem das Bewusstsein durch Quanteneffekte entsteht, die in subzellulären Strukturen innerhalb der Neuronen, den Mikrotubuli, auftreten. Das Modell geht von so genannten „objektiven Zusammenbrüchen“ aus, bei denen sich das Quantensystem von einer Überlagerung mehrerer möglicher Zustände zu einem einzigen, eindeutigen Zustand bewegt, ohne dass ein Beobachter oder eine Messung eingreift, wie es in den meisten quantenmechanischen Modellen der Fall ist. Laut Penrose und Hameroff ist die Umgebung innerhalb der Mikrotubuli für solche objektiven Zusammenbrüche besonders geeignet, und die daraus resultierenden Selbstzusammenbrüche erzeugen einen kohärenten Fluss, der die neuronale Aktivität reguliert und nicht-algorithmische mentale Prozesse ermöglicht.
Der Psychiater Ian Marshall hat ein Modell vorgeschlagen, das die kohärente Einheit des Bewusstseins dadurch erklären soll, dass im Gehirn ein physikalischer Zustand erzeugt wird, der dem eines Bose-Einstein-Kondensats ähnelt. Letzteres ist ein Quantenphänomen, bei dem eine Ansammlung von Atomen als eine einzige kohärente Einheit agiert und die Unterscheidung zwischen einzelnen Atomen verloren geht. Auch wenn Gehirnzustände nicht buchstäblich Beispiele für Bose-Einstein-Kondensate sind, wurden Gründe dafür angeführt, warum Gehirne wahrscheinlich Zustände hervorbringen, die eine ähnliche Kohärenz aufweisen (Marshall und Zohar 1990).
Eine Grundlage für das Bewusstsein wurde auch in der holistischen Natur der Quantenmechanik und dem Phänomen der Verschränkung gesucht, wonach die Eigenschaften von Teilchen, die miteinander in Wechselwirkung getreten sind, auch nach ihrer Trennung weiterhin voneinander abhängen. Es überrascht nicht, dass diese Modelle vor allem auf die Erklärung der Kohärenz des Bewusstseins abzielen, aber sie wurden auch als allgemeinere Herausforderung an die atomistische Konzeption der traditionellen Physik herangezogen, nach der die Eigenschaften des Ganzen durch den Rückgriff auf die Eigenschaften seiner Teile plus deren Kombinationsweise zu erklären sind – eine Erklärungsmethode, die bisher als erfolglos für die Erklärung des Bewusstseins angesehen werden kann (Silberstein 1998, 2001).
Andere haben die Quantenmechanik zum Anlass genommen, um darauf hinzuweisen, dass das Bewusstsein eine absolut fundamentale Eigenschaft der physikalischen Realität ist – eine Eigenschaft, die auf der grundlegendsten Ebene mit einbezogen werden muss (Stapp 1993). Sie berufen sich vor allem auf die Rolle des Beobachters beim Zusammenbruch der Wellenfunktion, d. h. dem Zusammenbruch der Quantenrealität von einer Überlagerung möglicher Zustände zu einem einzigen eindeutigen Zustand, wenn eine Messung vorgenommen wird. Solche Modelle können eine Form des Quasi-Idealismus beinhalten, in der die Existenz der physikalischen Realität davon abhängt, dass sie bewusst beobachtet wird.
In der Literatur finden sich noch viele andere Quantenmodelle des Bewusstseins – einige vertreten eine radikal revidierte Metaphysik, andere nicht -, aber diese vier bieten eine vernünftige, wenn auch unvollständige Auswahl der Alternativen.
9.9 Nicht-physikalische Theorien
Die meisten spezifischen Theorien des Bewusstseins – ob kognitiv, neuronal oder quantenmechanisch – zielen darauf ab, das Bewusstsein als ein natürliches Merkmal der physischen Welt zu erklären oder zu modellieren. Wer jedoch eine physikalistische Ontologie des Bewusstseins ablehnt, muss Wege finden, es als einen nicht-physikalischen Aspekt der Realität zu modellieren. Daher müssen diejenigen, die eine dualistische oder antiphysikalische metaphysische Sichtweise vertreten, letztendlich spezifische Modelle des Bewusstseins vorlegen, die sich von den fünf oben genannten Typen unterscheiden. Sowohl Substanzdualisten als auch Eigenschaftsdualisten müssen die Details ihrer Theorien so entwickeln, dass sie die spezifischen Eigenschaften der relevanten nicht-physikalischen Merkmale der Realität, mit denen sie das Bewusstsein gleichsetzen oder auf die sie sich berufen, um es zu erklären, deutlich machen.
Es wurde eine Vielzahl solcher Modelle vorgeschlagen, darunter die folgenden. David Chalmers (1996) hat eine zugegebenermaßen spekulative Version des Panpsychismus vorgeschlagen, die an den Begriff der Information appelliert nicht nur, um psychophysische Invarianzen zwischen phänomenalen und physisch realisierten Informationsräumen zu erklären, sondern auch, um möglicherweise die Ontologie des Physischen selbst als aus dem Informationellen abgeleitet zu erklären (eine Version der „It from Bit“-Theorie). In ähnlicher Weise hat Gregg Rosenberg (2004) eine Erklärung des Bewusstseins vorgeschlagen, die gleichzeitig die ultimative kategoriale Basis kausaler Beziehungen anspricht. Sowohl im kausalen als auch im bewussten Fall argumentiert Rosenberg, dass die relational-funktionalen Fakten letztlich von einer kategorialen, nicht-relationalen Basis abhängen müssen, und er bietet ein Modell an, nach dem kausale Beziehungen und qualitative phänomenale Fakten beide von derselben Basis abhängen. Wie bereits erwähnt (Abschnitt 9.8), behandeln einige Quantentheorien das Bewusstsein als ein grundlegendes Merkmal der Realität (Stapp 1993), und insofern sie dies tun, könnten sie plausibelerweise auch als nicht-physikalische Theorien klassifiziert werden.
10. Schlussfolgerung
Ein umfassendes Verständnis des Bewusstseins wird wahrscheinlich Theorien vieler Arten erfordern. Man könnte sinnvollerweise und widerspruchsfrei eine Vielzahl von Modellen akzeptieren, die jeweils auf ihre eigene Weise darauf abzielen, die physikalischen, neuronalen, kognitiven, funktionalen, repräsentativen und übergeordneten Aspekte des Bewusstseins zu erklären. Es ist unwahrscheinlich, dass es eine einzige theoretische Perspektive gibt, die ausreicht, um alle Merkmale des Bewusstseins, die wir verstehen wollen, zu erklären. Daher könnte ein synthetischer und pluralistischer Ansatz der beste Weg zu künftigen Fortschritten sein.
Bibliografie
- Akins, K. 1993. “A bat without qualities?” In M. Davies and G. Humphreys, eds. Consciousness: Psychological and Philosophical Essays. Oxford: Blackwell.
- Akins, K. 1996. “Lost the plot? Reconstructing Dennett’s multiple drafts theory of consciousness.” Mind and Language, 11: 1–43.
- Anderson, J. 1983. The Architecture of Cognition. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Armstrong, D. 1968. A Materialist Theory of Mind, London: Routledge and Kegan Paul.
- Armstrong, D. 1981. “What is consciousness?” In The Nature of Mind. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Baars, B. 1988. A Cognitive Theory of Consciousness. Cambridge: Cambridge University Press.
- Balog, K. 1999. “Conceivability, possibility, and the mind-body problem.” Philosophical Review, 108: 497–528.
- Bayne, T. 2010. The Unity of Consciousness. Oxford: Oxford University Press.
- Bayne, T. and Montague, M. (eds.) 2012. Cognitive Phenomenology. Oxford: Oxford University Press.
- Block, N. 1980a. “Troubles with Functionalism,” in Readings in the Philosophy of Psychology, Volume 1, Ned Block,ed., Cambridge, MA : Harvard University Press, 268–305.
- Block, N. 1980b. “Are absent qualia impossible?” Philosophical Review, 89/2: 257–74.
- Block, N. 1990. “Inverted Earth,” Philosophical Perspectives, 4, J. Tomberlin, ed., Atascadero, CA: Ridgeview Publishing Company.
- Block, N. 1995. “On a confusion about the function of consciousness.” Behavioral and Brain Sciences, 18: 227–47.
- Block, N. 1994. “What is Dennett’s theory a theory of?” Philosophical Topics, 22/1–2: 23–40.
- Block, N. 1996. “Mental paint and mental latex.” In E. Villanueva, ed. Perception. Atascadero, CA: Ridgeview.
- Block, N. and Stalnaker, R. 1999. “Conceptual analysis, dualism, and the explanatory gap.” Philosophical Review, 108/1: 1–46.
- Block, N. 2007. Consciousness, Accessibility and the mesh between psychology and neuroscience. Behavioral and Brain Sciences 30: 481–548
- Boyd, R. 1980. “Materialism without reductionism: What physicalism does not entail.” In N. Block, ed. Readings in the Philosophy of Psychology, Vol. 1. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Byrne, A. 1997. “Some like it HOT: consciousness and higher-order thoughts.” Philosophical Studies, 2: 103–29.
- Byrne, A. 2001. “Intentionalism defended”. Philosophical Review, 110: 199–240.
- Campbell, K. 1970. Body and Mind. New York: Doubleday.
- Campbell, J. 1994. Past, Space, and Self. Cambridge, MA: MIT Press.
- Carruthers, P. 2000. Phenomenal Consciousness. Cambridge: Cambridge University Press.
- Carruthers, Peter and Veillet, Benedicte (2011). The case against cognitive phenomenology. In T. Bayne and M. Montague (eds.) Cognitive Phenomenology. Oxford: Oxford University Press.
- Chalmers, D. 1995. “Facing up to the problem of consciousness”. Journal of Consciousness Studies, 2: 200–19.
- Chalmers, D. 1996. The Conscious Mind. Oxford: Oxford University Press.
- Chalmers, D. 2002. “Does conceivability entail possibility?” In T. Gendler and J. Hawthorne eds. Conceivability and Possibility. Oxford: Oxford University Press.
- Chalmers, D. 2003. “The content and epistemology of phenomenal belief.” In A. Jokic and Q. Smith eds. Consciousness: New Philosophical Perspectives. Oxford: Oxford University Press.
- Chalmers, D. and Jackson, F. 2001. “Conceptual analysis and reductive explanation”. Philosophical Review, 110/3: 315–60.
- Churchland, P. M. 1985. “Reduction, qualia, and direct introspection of brain states”. Journal of Philosophy, 82: 8–28.
- Churchland, P. M. 1995. The Engine of Reason and Seat of the Soul. Cambridge, MA: MIT Press.
- Churchland, P. S. 1981. “On the alleged backwards referral of experiences and its relevance to the mind body problem”. Philosophy of Science, 48: 165–81.
- Churchland, P. S. 1983. “Consciousness: the transmutation of a concept”. Pacific Philosophical Quarterly, 64: 80–95.
- Churchland, P. S. 1996. “The hornswoggle problem”. Journal of Consciousness Studies, 3: 402–8.
- Clark, A. 1993. Sensory Qualities. Oxford: Oxford University Press.
- Clark, G. and Riel-Salvatore, J. 2001. “Grave markers, middle and early upper paleolithic burials”. Current Anthropology, 42/4: 481–90.
- Cleeremans, A., ed. 2003. The Unity of Consciousness: Binding, Integration and Dissociation. Oxford: Oxford University Press.
- Crick, F. and Koch, C. 1990. “Toward a neurobiological theory of consciousness”. Seminars in Neuroscience, 2: 263–75.
- Crick, F. H. 1994. The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul. New York: Scribners.
- Davies, M. and Humphreys, G. 1993. Consciousness: Psychological and Philosophical Essays. Oxford: Blackwell.
- Damasio, A. 1999. The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness. New York: Harcourt.
- Dehaene, S. and Naccache, L. 2000. Towards a cognitive neuroscience of consciousness: basic evidence and a workspace framework. Cognition 79:1–37.
- Dennett, D. C. 1978. Brainstorms. Cambridge: MIT Press.
- Dennett, D. C. 1984. Elbow Room: The Varieties of Free Will Worth Having. Cambridge: MIT Press.
- Dennett, D. C. 1990. “Quining qualia”. In Mind and Cognition, W. Lycan, ed., Oxford: Blackwell, 519–548.
- Dennett, D. C. 1991. Consciousness Explained. Boston: Little, Brown and Company.
- Dennett, D. C. 1992. “The self as the center of narrative gravity”. In F. Kessel, P. Cole, and D. L. Johnson, eds. Self and Consciousness: Multiple Perspectives. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Dennett, D. C. 2003. Freedom Evolves. New York: Viking.
- Dennett, D. C. and Kinsbourne, M. 1992. “Time and the observer: the where and when of consciousness in the brain”. Behavioral and Brain Sciences, 15: 187–247.
- Descartes, R. 1644/1911. The Principles of Philosophy. Translated by E. Haldane and G. Ross. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dretske, F. 1993. “Conscious experience.” Mind, 102: 263–283.
- Dretske, F. 1994. “Differences that make no difference”. Philosophical Topics, 22/1–2: 41–58.
- Dretske, F. 1995. Naturalizing the Mind. Cambridge, Mass: The MIT Press, Bradford Books.
- Eccles, J. and Popper, K. 1977. The Self and Its Brain: An Argument for Interactionism. Berlin: Springer
- Edelman, G. 1989. The Remembered Present: A Biological Theory of Consciousness. New York: Basic Books.
- Farah, M. 1990. Visual Agnosia. Cambridge: MIT Press.
- Flanagan, O. 1992. Consciousness Reconsidered. Cambridge, MA: MIT Press.
- Flohr, H. 1995. “An information processing theory of anesthesia”. Neuropsychologia, 33/9: 1169–80.
- Flohr, H., Glade, U. and Motzko, D. 1998. “The role of the NMDA synapse in general anesthesia”. Toxicology Letters, 100–101: 23–29.
- Fodor, J. 1974. “Special sciences”. Synthese,28: 77–115.
- Fodor, J. 1983. The Modularity of Mind. Cambridge, MA: MIT Press.
- Foster, J. 1989. “A defense of dualism”. In J. Smythies and J. Beloff, eds. The Case for Dualism. Charlottesville, VA: University of Virginia Press.
- Foster J. 1996. The Immaterial Self: A Defence of the Cartesian Dualist Conception of Mind. London: Routledge.
- Gallistel, C. 1990. The Organization of Learning. Cambridge, MA: MIT Press.
- Gardiner, H. 1985. The Mind’s New Science. New York: Basic Books.
- Gazzaniga, M. 1988. Mind Matters: How Mind and Brain Interact to Create our Conscious Lives. Boston: Houghton Mifflin.
- Gazzaniga, M. 2011. Who’s In Charge? Free Will and the Science of the Brain, New York: Harper Collins.
- Gennaro, R. 1995. Consciousness and Self-consciousness: A Defense of the Higher-Order Thought Theory of Consciousness. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
- Gennaro, R., ed. 2004. Higher-Order Theories of Consciousness. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
- Gennaro, R. 2012. The Consciousness Paradox. Cambridge, MA: MIT Press.
- Gray, J. 1995. “The contents of consciousness: a neuropsychological conjecture”. Behavior and Brain Sciences, 18/4: 659–722.
- Hameroff, S. 1998. “Quantum computation in brain microtubules? The Penrose-Hameroff ‘Orch OR’ model of consciousness”. Philosophical Transactions Royal Society London, A 356: 1869–96.
- Hardin, C. 1986. Color for Philosophers. Indianapolis: Hackett.
- Hardin, C. 1992. “Physiology, phenomenology, and Spinoza’s true colors”. In A. Beckermann, H. Flohr, and J. Kim, eds. Emergence or Reduction?: Prospects for Nonreductive Physicalism. Berlin and New York: De Gruyter.
- Harman, G. 1990. “The intrinsic quality of experience”. In J. Tomberlin, ed. Philosophical Perspectives, 4. Atascadero, CA: Ridgeview Publishing.
- Hartshorne, C. 1978. “Panpsychism: mind as sole reality”. Ultimate Reality and Meaning,1: 115–29.
- Hasker, W. 1999. The Emergent Self. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Heidegger, M. 1927/1962. Being and Time (Sein und Zeit). Translated by J. Macquarrie and E. Robinson. New York: Harper and Row.
- Hellman, G. and Thompson, F. 1975. “Physicalism: ontology, determination and reduction”. Journal of Philosophy, 72: 551–64.
- Hill, C. 1991. Sensations:A Defense of Type Materialism. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hill, C. 1997. “Imaginability, conceivability, possibility, and the mind-body problem”. Philosophical Studies, 87: 61–85.
- Hill, C. and McLaughlin, B. 1998. “There are fewer things in reality than are dreamt of in Chalmers‘ philosophy”. Philosophy and Phenomenological Research, 59/2: 445–54.
- Horgan, T. 1984. “Jackson on Physical Information and Qualia.” Philosophical Quarterly, 34: 147–83.
- Horgan, T. and Tienson, J. 2002. “The intentionality of phenomenology and the phenomenology of intentionality”. In D. J. Chalmers , ed., Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings. New York: Oxford University Press.
- Hume, D. 1739/1888. A Treatise of Human Nature. ed. L Selby-Bigge. Oxford: Oxford University Press.
- Humphreys, N. 1982. Consciousness Regained. Oxford: Oxford University Press.
- Humphreys, N. 1992. A History of the Mind. London: Chatto and Windus.
- Husserl, E. 1913/1931. Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology (Ideen au einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie). Translated by W. Boyce Gibson. New York: MacMillan.
- Husserl, E. 1929/1960. Cartesian Meditations: an Introduction to Phenomenology. Translated by Dorian Cairns. The Hague: M. Nijhoff.
- Huxley, T. 1866. Lessons on Elementary Physiology 8. London
- Huxley, T. 1874. “On the hypothesis that animals are automata”. Fortnightly Review, 95: 555–80. Reprinted in Collected Essays. London, 1893.
- Hurley, S. 1998. Consciousness in Action. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Jackson, F. 1982. “Epiphenomenal qualia”. Philosophical Quarterly, 32: 127–136.
- Jackson, F. 1986. “What Mary didn’t know”. Journal of Philosophy, 83: 291–5.
- Jackson, F. 1993. “Armchair metaphysics”. In J. O’Leary-Hawthorne and M. Michael, eds. Philosophy of Mind. Dordrecht: Kluwer Books.
- Jackson, F. 1998. “Postscript on qualia”. In F. Jackson Mind, Method and Conditionals. London: Routledge.
- Jackson, F. 2004. “Mind and illusion.” In P. Ludlow, Y. Nagasawa and D. Stoljar eds. There’s Something about Mary: Essays on the Knowledge Argument. Cambridge, MA: MIT Press.
- James, W. 1890. The Principles of Psychology. New York: Henry Holt and Company.
- Jaynes, J. 1974. The Origins of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Boston: Houghton Mifflin.
- Kant, I. 1787/1929. Critique of Pure Reason. Translated by N. Kemp Smith. New York: MacMillan.
- Kim, J. 1987. “The myth of non-reductive physicalism”. Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association.
- Kim, J. 1998. Mind in Physical World. Cambridge: MIT Press.
- Kind, A. 2003. What’s so transparent about transparency? Philosophical Studies 115(3): 225–44.
- Kant, I. 1787/1929. Critique of Pure Reason. Translated by N. Kemp Smith. New York: MacMillan.
- Kinsbourne, M. 1988. “Integrated field theory of consciousness”. In A. Marcel and E. Bisiach, eds. Consciousness in Contemporary Science. Oxford: Oxford University Press.
- Kirk, R. 1974. “Zombies vs materialists”. Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume, 48: 135–52.
- Kirk, R. 1991. “Why shouldn’t we be able to solve the mind-body problem?” Analysis, 51: 17–23.
- Köhler, W. 1929. Gestalt Psychology. New York: Liveright.
- Köffka, K. 1935. Principles of Gestalt Psychology. New York: Harcourt Brace.
- Koch, C. 2012. Consciousness: Confessions of a Romantic Reductionist. Cambridge, MA: MIT Press.
- Kriegel, U. 2009. Subjective Consciousness. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Kriegel, U. and Williford, K. 2006. Self Representational Approaches to Consciousness. Cambridge, MA: MIT Press 2006.
- Lamme, V. 2006. Toward a true neural stance on consciousness. Trends in Cognitive Science 10:11, 494–501.
- Leibniz, G. W. 1686 /1991. Discourse on Metaphysics. Translated by D. Garter and R. Aries. Indianapolis: Hackett.
- Leibniz, G. W. 1720/1925. The Monadology. Translated by R. Lotte. London: Oxford University Press.
- Levine, J. 1983. “Materialism and qualia: the explanatory gap”. Pacific Philosophical Quarterly, 64: 354–361.
- Levine, J. 1993. “On leaving out what it’s like”. In M. Davies and G. Humphreys, eds. Consciousness: Psychological and Philosophical Essays. Oxford: Blackwell.
- Levine, J. 1994. “Out of the closet: a qualophile confronts qualophobia”. Philosophical Topics, 22/1–2: 107–26.
- Levine, J. 2001. Purple Haze: The Puzzle of Conscious Experience. Cambridge, Mass: The MIT Press.
- Lewis, D. 1972. “Psychophysical and theoretical identifications”. Australasian Journal of Philosophy, 50: 249–58.
- Lewis, D. 1990. “What experience teaches.” In W. Lycan, ed. Mind and Cognition: A Reader. Oxford: Blackwell.
- Libet, B. 1982. “Subjective antedating of a sensory experience and mind-brain theories”. Journal of Theoretical Biology, 114: 563–70.
- Libet, B. 1985. “Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action”. Behavioral and Brain Sciences, 8: 529–66.
- Llinas, R. 2001. I of the vortex: from neurons to self. Cambridge, MA: MIT Press
- Loar, B. 1990. “Phenomenal states,” in Philosophical Perspectives, 4: 81–108.
- Loar, B. 1997. “Phenomenal states”. In N. Block, O. Flanagan, and G. Guzeldere eds. The Nature of Consciousness. Cambridge, MA: MIT Press.
- Locke, J. 1688/1959. An Essay on Human Understanding. New York: Dover.
- Lockwood, M. 1989. Mind, Brain, and the Quantum. Oxford: Oxford University Press.
- Lorenz, K. 1977. Behind the Mirror (Rückseite dyes Speigels). Translated by R. Taylor. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Lycan, W. 1987. Consciousness. Cambridge, MA: MIT Press.
- Lycan, W. 1996. Consciousness and Experience. Cambridge, MA: MIT Press.
- Lycan, W. 2004. “The superiority of HOP to HOT”. In R. Gennaro ed. Higher-Order Theories of Consciousness. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
- Marshall, I. and Zohar, D. 1990. The Quantum Self: Human Nature and Consciousness Defined by the New Physics. New York: Morrow.
- McGinn, C. 1989. “Can we solve the mind-body problem?” Mind, 98: 349–66
- McGinn, C. 1991. The Problem of Consciousness. Oxford: Blackwell.
- McGinn, C. 1995. “Consciousness and space.” In T. Metzinger, ed. Conscious Experience. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Merleau-Ponty, M. 1945/1962. Phenomenology of Perception (Phénoménologie de lye Perception). Translated by Colin Smith. London: Routledge and Kegan Paul.
- Metzinger, T., ed. 1995. Conscious Experience. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Metzinger, T. ed. 2000. Neural Correlates of Consciousness: Empirical and Conceptual Questions. Cambridge, MA: MIT Press.
- Mill, J. 1829. Analysis of the Phenomena of the Human Mind. London.
- Mill, J.S. 1865. An Analysis of Sir William Hamilton’s Philosophy. London.
- Moore, G. E. 1922. “The refutation of idealism.” In G. E. Moore Philosophical Studies. London : Routledge and Kegan Paul.
- Nagel, T. 1974. “What is it like to be a bat?” Philosophical Review, 83: 435–456.
- Nagel, T. 1979. “Panpsychism.” In T. Nagel Mortal Questions. Cambridge: Cambridge University Press.
- Natsoulas, T. 1983. “Concepts of consciousness.” Journal of Mind and Behavior, 4: 195–232.
- Nelkin, N. 1989. “Unconscious sensations.” Philosophical Psychology, 2: 129–41.
- Nemirow, L. 1990. “Physicalism and the cognitive role of acquaintance.” In W. Lycan, ed. Mind and Cognition: A Reader. Oxford: Blackwell.
- Neisser, U. 1965. Cognitive Psychology. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Nida-Rümelin, M. 1995. “What Mary couldn’t know: belief about phenomenal states.” In T. Metzinger, ed. Conscious Experience. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Panksepp, J. 1998. Affective Neuroscience. Oxford: Oxford University Press.
- Papineau, D. 1994. Philosophical Naturalism. Oxford: Blackwell.
- Papineau, D. 1995. “The antipathetic fallacy and the boundaries of consciousness.” In T. Metzinger, ed. Conscious Experience. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Papineau, D. 2002. Thinking about Consciousness. Oxford: Oxford University Press.
- Peacocke, C. 1983. Sense and Content, Oxford: Oxford University Press.
- Pearson, M.P. 1999. The Archeology of Death and Burial. College Station, Texas: Texas A&M Press.
- Penfield, W. 1975. The Mystery of the Mind: a Critical Study of Consciousness and the Human Brain. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Perry, J. 2001. Knowledge, Possibility, and Consciousness. Cambridge, MA: MIT Press.
- Penrose, R. 1989. The Emperor’s New Mind: Computers, Minds and the Laws of Physics. Oxford: Oxford University Press.
- Penrose, R. 1994. Shadows of the Mind. Oxford: Oxford University Press.
- Pitt, D. 2004. The phenomenology of cognition or what is it like to believe that p? Philosophy and Phenomenological Research 69: 1–36.
- Place, U. T. 1956. “Is consciousness a brain process?” British Journal of Psychology, 44–50.
- Prinz, J. 2012. The Conscious Brain. Oxford: Oxford University Press.
- Putnam, H. 1975. “Philosophy and our mental life.” In H. Putnam Mind Language and Reality: Philosophical Papers Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, H. and Oppenheim, P. 1958. “Unity of science as a working hypothesis.” In H. Fiegl, G. Maxwell, and M. Scriven eds. Minnesota Studies in the Philosophy of Science II. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Rey, G. 1986. “A question about consciousness.” In H. Otto and J. Tuedio, eds. Perspectives on Mind. Dordrecht: Kluwer.
- Robinson, H. 1982. Matter and Sense: A Critique of Contemporary Materialism. Cambridge: Cambridge University Press.
- Robinson, D. 1993. “Epiphenomenalism, laws, and properties.” Philosophical Studies, 69: 1–34.
- Rosenberg, G. 2004. A Place for Consciousness: Probing the Deep Structure of the Natural World. New York: Oxford University Press.
- Rosenthal, D. 1986. “Two concepts of consciousness.” Philosophical Studies, 49: 329–59.
- Rosenthal, D. 1991. “The independence of consciousness and sensory quality.” In E. Villanueva, ed. Consciousness. Atascadero, CA: Ridgeview Publishing.
- Rosenthal, D. M. 1993. “Thinking that one thinks.” In M. Davies and G. Humphreys, eds. Consciousness: Psychological and Philosophical Essays. Oxford: Blackwell.
- Rosenthal, D. 1994. “First person operationalism and mental taxonomy.” Philosophical Topics, 22/1–2: 319–50.
- Rosenthal, D. M. 1997. “A theory of consciousness.” In N. Block, O. Flanagan, and G. Guzeldere, eds. The Nature of Consciousness. Cambridge, MA: MIT Press.
- Russell, B. 1927. The Analysis of Matter. London: Kegan Paul.
- Ryle, G. 1949. The Concept of Mind. London: Hutchinson and Company.
- Sacks, O. 1985. The Man who Mistook his Wife for a Hat. New York: Summit.
- Schacter, D. 1989. “On the relation between memory and consciousness: dissociable interactions and consciousness.” In H. Roediger and F. Craik eds. Varieties of Memory and Consciousness. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Schneider W. and Shiffrin, R. 1977. “Controlled and automatic processing: detection, search and attention.” Psychological Review, 84: 1–64.
- Searle, J. R. 1990. “Consciousness, explanatory inversion and cognitive science.” Behavioral and Brain Sciences, 13: 585–642.
- Searle, J. 1992. The Rediscovery of the Mind. Cambridge, MA: MIT Press.
- Seager, W. 1995. “Consciousness, information, and panpsychism.” Journal of Consciousness Studies, 2: 272–88.
- Seigel, S. 2010. The Contents of Visual Experience. Oxford: Oxford University Press.
- Siewert, C. 1998. The Significance of Consciousness. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Shallice, T. 1988. From Neuropsychology to Mental Structure. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shear, J. 1997. Explaining Consciousness: The Hard Problem. Cambridge, MA: MIT Press.
- Shoemaker, S. 1975. “Functionalism and qualia,” Philosophical Studies, 27: 291–315.
- Shoemaker, S. 1981. “Absent qualia are impossible.” Philosophical Review, 90: 581–99.
- Shoemaker, S. 1982. “The inverted spectrum.” Journal of Philosophy, 79: 357–381.
- Shoemaker, S. 1990. “Qualities and qualia: what’s in the mind,” Philosophy and Phenomenological Research, Supplement, 50: 109–131.
- Shoemaker, S. 1998. “Two cheers for representationalism,” Philosophy and Phenomenological Research.
- Silberstein, M. 1998. “Emergence and the mind-body problem.” Journal of Consciousness Studies, 5: 464–82.
- Silberstein, M 2001. “Converging on emergence: consciousness, causation and explanation.” Journal of Consciousness Studies, 8: 61–98.
- Singer, P. 1975. Animal Liberation. New York: Avon Books.
- Singer, W. 1999. “Neuronal synchrony: a versatile code for the definition of relations.” Neuron, 24: 49–65.
- Skinner, B. F. 1953. Science and Human Behavior. New York: MacMillan.
- Smart, J. 1959. “Sensations and brain processes.” Philosophical Review, 68: 141–56.
- Stapp, H. 1993. Mind, Matter and Quantum Mechanics. Berlin: Springer Verlag.
- Stoljar, D. 2001. “Two conceptions of the physical.” Philosophy and Phenomenological Research, 62: 253–81
- Strawson, G. 1994. Mental Reality. Cambridge, Mass: MIT Press, Bradford Books.
- Strawson, G. 2005. Real intentionality. Phenomenology and the Cognitive Sciences 3(3): 287–313.
- Swinburne, R. 1986. The Evolution of the Soul. Oxford: Oxford University Press.
- Titchener, E. 1901. An Outline of Psychology. New York: Macmillan.
- Tononi, G. 2008. Consciousness as integrated information: a provisional manifesto. Biological Bulletin 215: 216–42.
- Travis, C. 2004. “The silence of the senses.” Mind, 113: 57–94.
- Triesman, A. and Gelade, G. 1980. “A feature integration theory of attention.” Cognitive Psychology, 12: 97–136.
- Tye, M. 1995. Ten Problems of Consciousness. Cambridge, MA: MIT Press.
- Tye, M. 2000. Consciousness, Color, and Content. Cambridge, MA: MIT Press.
- Tye, M. 2003. “Blurry images, double vision and other oddities: new troubles for representationalism?” In A. Jokic and Q. Smith eds., Consciousness: New Philosophical Perspectives. Oxford: Oxford University Press.
- Tye, M. 2005. Consciousness and Persons. Cambridge,MA: MIT Press.
- Tye, M. and Wright, B. 2011. Is There a Phenomenology of Thought? In T. Bayne and M. Montague (eds.) Cognitive Phenomenology. Oxford: Oxford University Press.
- Van Gulick, R. 1985. “Physicalism and the subjectivity of the mental.” Philosophical Topics, 13: 51–70.
- Van Gulick, R. 1992. “Nonreductive materialism and intertheoretical constraint.” In A. Beckermann, H. Flohr, J. Kim, eds. Emergence and Reduction. Berlin and New York: De Gruyter, 157–179.
- Van Gulick, R. 1993. “Understanding the phenomenal mind: Are we all just armadillos?” In M. Davies and G. Humphreys, eds., Consciousness: Psychological and Philosophical Essays. Oxford: Blackwell.
- Van Gulick, R. 1994. “Dennett, drafts and phenomenal realism.” Philosophical Topics, 22/1–2: 443–56.
- Van Gulick, R. 1995. “What would count as explaining consciousness?” In T. Metzinger, ed. Conscious Experience. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Van Gulick, R. 2000. “Inward and upward: reflection, introspection and self-awareness.” Philosophical Topics, 28: 275–305.
- Van Gulick, R. 2003. “Maps, gaps and traps.” In A. Jokic and Q. Smith eds. Consciousness: New Philosophical Perspectives. Oxford: Oxford University Press.
- Van Gulick, R. 2004. “Higher-order global states HOGS: an alternative higher-order model of consciousness.” In Gennaro, R. ed. Higher-Order Theories of Consciousness. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
- van Inwagen, P. 1983. An Essay on Free Will. Oxford: Oxford University Press.
- Varela, F. and Maturana, H. 1980. Cognition and Autopoiesis. Dordrecht: D. Reidel.
- Varela, F. 1995. “Neurophenomenology: A methodological remedy for the hard problem.” Journal of Consciousness Studies, 3: 330–49.
- Varela, F. and Thomson, E. 2003. “Neural synchronicity and the unity of mind: a neurophenomenological perspective.” In Cleermans, A. ed. The Unity of Consciousness: Binding, Integration, and Dissociation. Oxford: Oxford University Press
- Velmans, M. 1991. “Is Human information processing conscious?” Behavioral and Brain Sciences, 14/4: 651–668
- Velmans, M. 2003. “How could conscious experiences affect brains?” Journal of Consciousness Studies, 9: 3–29.
- von Helmholtz, H. 1897/1924. Treatise on Physiological Optics. Translated by J. Soothly. New York: Optical Society of America.
- Wilkes, K. V. 1984. “Is consciousness important?” British Journal for the Philosophy of Science, 35: 223–43.
- Wilkes, K. V. 1988. “Yishi, duo, us and consciousness.” In A. Marcel and E. Bisiach, eds., Consciousness in Contemporary Science. Oxford: Oxford University Press.
- Wilkes, K. V. 1995. “Losing consciousness.” In T. Metzinger, ed. Conscious Experience. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Watson, J. 1924. Behaviorism. New York: W. W. Norton.
- Wegner, D. 2002. The Illusion of Conscious Will. Cambridge, MA: MIT Press.
- Wittgenstein, L. 1921/1961. Tractatus Logico-Philosophicus. Translated by D. Pears and B. McGuinness. London: Routledge and Kegan Paul.
- Wundt, W. 1897. Outlines of Psychology. Leipzig: W. Engleman.
- Yablo, S. 1998. “Concepts and consciousness.” Philosophy and Phenomenological Research, 59: 455–63.