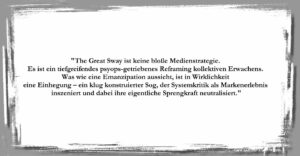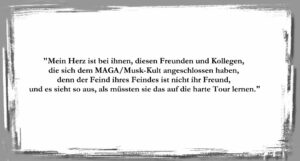Der Rückgang des Spielens und der Anstieg der Psychopathologie bei Kindern und Heranwachsenden – Peter Otis Gray
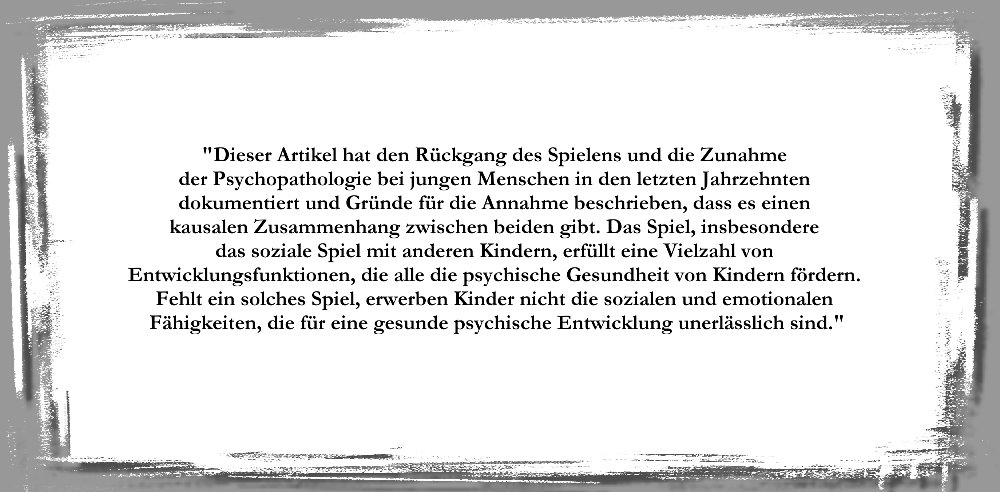
Im letzten halben Jahrhundert ist in den Vereinigten Staaten und anderen Industrieländern das freie Spiel der Kinder mit anderen Kindern stark zurückgegangen. Im gleichen Zeitraum haben Angstzustände, Depressionen, Selbstmord, Gefühle der Hilflosigkeit und Narzissmus bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen stark zugenommen. Dieser Artikel dokumentiert diese historischen Veränderungen und stellt die These auf, dass der Rückgang des Spielens zum Anstieg der Psychopathologie bei jungen Menschen beigetragen hat. Spielen ist das wichtigste Mittel, durch das Kinder (1) intrinsische Interessen und Kompetenzen entwickeln, (2) lernen, Entscheidungen zu treffen, Probleme zu lösen, Selbstkontrolle auszuüben und Regeln zu befolgen, (3) lernen, ihre Emotionen zu regulieren, (4) Freundschaften schließen und lernen, mit anderen auf Augenhöhe auszukommen, und (5) Freude erleben. Durch all diese Effekte fördert das Spielen die psychische Gesundheit.
Kinder SIND durch natürliche Auslese zum Spielen BESTIMMT. Wo immer Kinder frei spielen können, spielen sie auch. Weltweit und im Laufe der Geschichte fand das meiste dieser Spiele im Freien mit anderen Kindern statt. Der außergewöhnliche menschliche Spieltrieb in der Kindheit und der Wert des Spiels zeigen sich am deutlichsten in Jäger- und Sammlerkulturen. Anthropologen und andere Beobachter haben regelmäßig berichteten, dass Kinder in solchen Kulturen jeden Tag, im Wesentlichen von morgens bis abends, frei spielen und erforschen – selbst in ihren Teenagerjahren und dadurch die Fähigkeiten und Einstellungen erwerben, die für ein erfolgreiches Erwachsenenleben erforderlich sind.1
In den Vereinigten Staaten und in einigen anderen Industrienationen sind die Möglichkeiten für Kinder zu spielen, insbesondere im Freien mit anderen Kindern, im letzten halben Jahrhundert kontinuierlich zurückgegangen. Im gleichen Zeitraum sind die Werte für die Psychopathologie bei Kindern und Jugendlichen – einschließlich der Indizes für Angst, Depression, Gefühle der Hilflosigkeit und Narzissmus – kontinuierlich gestiegen. Dieser Artikel dokumentiert diesen Rückgang des Spielens und die Zunahme der Psychopathologie und argumentiert für einen kausalen Zusammenhang zwischen beiden. Der Mensch ist außerordentlich anpassungsfähig an Veränderungen seiner Lebensbedingungen, aber nicht unbegrenzt. Sie haben sich als Spezies unter Bedingungen entwickelt, in denen Kinder spielerisch lernten, mit anderen auszukommen, Probleme zu lösen, ihre Impulse zu hemmen und ihre Gefühle zu regulieren. Ich behaupte, dass junge Menschen ohne Spiel nicht die sozialen und emotionalen Fähigkeiten erwerben können, die für eine gesunde psychologische Entwicklung notwendig sind.
In diesem Artikel bezieht sich der Begriff „freies Spiel“ auf Aktivitäten, die von den Teilnehmern frei gewählt und geleitet werden und die um ihrer selbst willen unternommen werden und nicht bewusst verfolgt werden, um Ziele zu erreichen, die sich von der Aktivität selbst unterscheiden.2 Daher fallen Sport und Spiele für Kinder, die von Erwachsenen geleitet werden, nicht in die Kategorie des freien Spiels. Ich behaupte, dass der Wert des freien Spiels für die psychologische Entwicklung von Kindern von seinem selbstgesteuerten und intrinsisch lohnenden Charakter abhängt.
Rückgang des freien Spiels bei Kindern
Mit dem Aufkommen der Landwirtschaft haben sich die Möglichkeiten des freien Spiels für Kinder historisch gesehen verringert. In vielen Gesellschaften, die nach der Zeit der Jäger und Sammler entstanden, mussten Kinder einen großen Teil des Tages mit der Arbeit verbringen – in der Regel mit häuslichen und landwirtschaftlichen Aufgaben und mit der industriellen Revolution auch in Fabriken. Sie spielten, wann immer sie konnten, sogar während der Arbeit; und wenn sie spielten, spielten sie frei und ohne Anleitung durch Erwachsene. Für die Zeit vor der Mitte des 20. Jahrhunderts gibt es keine Daten, die die Spielmöglichkeiten mit dem psychischen Wohlbefinden der Kinder in Verbindung bringen, da das psychische Wohlbefinden damals nicht gemessen wurde. In diesem Artikel konzentriere ich mich auf den historischen Zeitraum von etwa 1955 bis heute, insbesondere in den Vereinigten Staaten, einem Zeitraum und Gebiet, für das wir zuverlässige Daten über das psychische Wohlbefinden junger Menschen haben.
Spielhistoriker haben mit guten Belegen behauptet, dass die Hochphase des freien Spiels von Kindern in Nordamerika die erste Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts umfasste. In seinem Buch über die Geschichte des Spiels in Amerika bezeichnet Howard Chudacoff diesen Zeitraum als „das goldene Zeitalter des unstrukturierten Spiels“.3 Mit unstrukturiertem Spiel meint Chudacoff ein Spiel, das von den Kindern selbst und nicht von Erwachsenen strukturiert wird, und auf diesen Begriff beziehe ich mich, wenn ich von freiem Spiel spreche. Um die Mitte des 20. Jahrhunderts waren die Kinder relativ frei von langen Arbeitszeiten, und eine gesteigerte Sentimentalität gegenüber der Kindheit förderte eine positive Einstellung zum freien Spiel der Kinder und die Entwicklung von Parks und anderen Spielräumen, um es zu fördern. Seit etwa 1955 ist das freie Spiel der Kinder jedoch kontinuierlich zurückgegangen, was zumindest teilweise darauf zurückzuführen ist, dass die Erwachsenen die Aktivitäten der Kinder außerhalb der Arbeitswelt immer stärker kontrollieren. Dieser Rückgang des Spiels in den letzten fünf bis sechs Jahrzehnten ist das Thema dieses Artikels.
Am auffälligsten und wahrscheinlich am stärksten zurückgegangen ist das Spiel der Kinder im Freien mit anderen Kindern. Jeder, der älter als vierzig ist, hat diesen Wandel aus erster Hand miterlebt. In den 1950er und 1960er Jahren und in geringerem Maße in den 1970er und 1980er Jahren konnte man in fast jeder nordamerikanischen Nachbarschaft – nach der Schule, an Wochenenden oder im Sommer – Kinder beim Spielen im Freien beobachten. Heute ist es in vielen Vierteln schwer, überhaupt Gruppen von Kindern im Freien zu finden, und wenn man sie findet, dann tragen sie wahrscheinlich Uniformen und folgen den Anweisungen von Trainern, während ihre Eltern pflichtbewusst zusehen und sie anfeuern. Diese Veränderungen wurden von anderen Spielhistorikern und auch von Chudacoff dokumentiert.4
Wie schnell und wie stark das freie Spiel der Kinder im letzten halben Jahrhundert zurückgegangen ist, lässt sich nur schwer quantifizieren, obwohl alle Historiker des Spiels davon ausgehen, dass der Rückgang kontinuierlich und groß war. Der objektivste Versuch einer solchen Quantifizierung, allerdings nur für einen Zeitraum von sechzehn Jahren, findet sich in der Arbeit von Soziologen der Universität von Michigan, die 1981 und erneut 1997 eine Bewertung der Zeitverwendung von Kindern vornahmen.5 In beiden Jahren baten sie eine große, repräsentative Stichprobe von Eltern in den Vereinigten Staaten, an von den Forschern zufällig ausgewählten Tagen Aufzeichnungen über die Aktivitäten ihrer Kinder zu führen. Sie fanden heraus, dass die Kinder 1997 nicht nur weniger spielten als 1981, sondern dass sie 1997 auch weniger Freizeit für alle selbst gewählten Aktivitäten hatten als 1981. Bei den Sechs- bis Achtjährigen stellten die Forscher beispielsweise fest, dass die Zeit, die sie mit Spielen verbrachten, um 25 Prozent, die Zeit, die sie zu Hause mit anderen unterhielten, um 55 Prozent und die Zeit, die sie vor dem Fernseher verbrachten, um 19 Prozent abnahm. Im Gegensatz dazu stellten sie fest, dass die Zeit, die in der Schule verbracht wurde, um 18 Prozent zunahm, die Zeit, die zu Hause mit Schularbeiten verbracht wurde, um 145 Prozent und die Zeit, die mit den Eltern beim Einkaufen verbracht wurde, um 168 Prozent. In dieser Studie umfasste die Kategorie „Spielen“ sowohl das Spielen in geschlossenen Räumen, wie Computer- und Brettspiele, als auch das Spielen im Freien. Wir können nur vermuten, dass das Spielen im Freien sogar um mehr als 25% zurückgegangen ist, da das Spielen am Computer in Innenräumen in diesem Zeitraum zugenommen haben muss (da es 1981 praktisch bei Null lag). Die Gesamtzeit, die ein durchschnittliches Kind dieser Altersgruppe 1997 mit Spielen (einschließlich Computerspielen) verbrachte, betrug etwas mehr als elf Stunden pro Woche.
In einer anderen Studie, die Rhonda Clements vor fast zehn Jahren durchführte, wurde eine repräsentative Stichprobe von 830 Müttern in den Vereinigten Staaten gebeten, das Spiel ihrer Kinder mit ihrem eigenen Spiel zu vergleichen, als sie selbst Kinder waren.6 85 Prozent der Mütter stimmten der Aussage zu, dass ihre eigenen Kinder (im Alter von drei bis zwölf Jahren) weniger im Freien spielten als sie selbst, als sie im Alter ihrer Kinder waren. Tatsächlich gaben 70 Prozent der Mütter an, dass sie als Kinder täglich im Freien gespielt hatten, und 56 Prozent sagten, dass sie, wenn sie im Freien spielten, in der Regel drei Stunden oder länger am Stück spielten. Bei der Beantwortung der gleichen Fragen zum Spiel ihrer Kinder lagen diese Prozentsätze bei nur 31% bzw. 22%. Ähnliche Ergebnisse, die die Wahrnehmung der Eltern dokumentieren, dass ihre Kinder viel weniger im Freien spielen, als sie (die Eltern) es als Kinder taten, wurden in kleineren Erhebungen im Vereinigten Königreich festgestellt.7
Der Rückgang des Spielens von Kindern im Freien wird häufig auf die verführerischen Qualitäten des Fernsehens und in jüngerer Zeit der Computerspiele und Internetaktivitäten zurückgeführt. Sicherlich haben diese technologischen Veränderungen eine Rolle gespielt. In der von Clements durchgeführten Umfrage nannten 85 Prozent der Mütter das Fernsehen und 81 Prozent das Spielen am Computer als Gründe dafür, dass ihre Kinder so selten im Freien spielten. In der gleichen Umfrage gaben jedoch die meisten Mütter zu, dass sie selbst das Spielen ihrer Kinder im Freien einschränkten, und 82 Prozent nannten Sicherheitsbedenken, einschließlich der Angst vor Kriminalität, als Grund dafür.
Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Kinder so viel Zeit mit Fernsehen und Spielen im Haus verbringen, weil sie nicht frei draußen spielen dürfen, und wenn sie doch draußen spielen dürfen, finden sie nicht die attraktiven Spielplätze und Gruppen anderer Kinder, mit denen sie spielen können, wie es in früheren Jahrzehnten der Fall war. Umfragen zeigen, dass Kinder nach wie vor am liebsten mit Freunden im Freien spielen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. In einer kürzlich durchgeführten internationalen Umfrage gaben 54 Prozent der Mütter an, dass „das Spielen im Freien auf einem Spielplatz oder in einem Park“ zu den Aktivitäten gehört, die ihre Kinder am glücklichsten machen. Das Spielen im Freien übertraf alle anderen Aktivitäten, einschließlich „Fernsehen, Filme oder Videos ansehen“ (41 Prozent) und „Elektronische Spiele benutzen“ (19 Prozent).8 In einer anderen kürzlich durchgeführten internationalen Umfrage, die von der IKEA Corporation gesponsert wurde, gaben 69 Prozent der Kinder in den Vereinigten Staaten (und 58 Prozent der Kinder in der gesamten internationalen Stichprobe) an, dass ihr bevorzugter Ort zum Spielen im Freien ist. In derselben Studie zeigten paarweise Vergleiche, dass 89 Prozent der Kinder das Spielen im Freien mit Freunden dem Fernsehen vorzogen, und 86 Prozent zogen es dem Spielen am Computer vor.9 Diese Ergebnisse traten auf, obwohl alle Kinder in der Studie mit Computern vertraut waren und zu Hause Zugang zu Computern hatten (die Umfrage wurde über das Internet durchgeführt).
Eltern haben heute mehr Angst davor, ihre Kinder im Freien spielen zu lassen, als Eltern in früheren Jahrzehnten, und die Medienberichterstattung spielt bei diesen Ängsten sicherlich eine Rolle. Wenn heute irgendwo in der entwickelten Welt ein Fremder ein Kind entführt, belästigt oder ermordet, wird über das Verbrechen ausführlich und wiederholt in den Nachrichten berichtet. In Wahrheit ist die Zahl solcher Fälle gering und zumindest seit den frühen 1990er Jahren in den Vereinigten Staaten rückläufig.10 Eltern sind jedoch anderer Meinung. In der IKEA-Umfrage war der am häufigsten genannte Grund, warum Eltern das Spielen ihrer Kinder im Freien einschränkten, die „Gefahr von Kinderräubern“ (49 Prozent der Eltern).11 Andere in der Umfrage geäußerte Befürchtungen, die möglicherweise realistischer sind, waren die Angst vor dem Straßenverkehr und vor Tyrannen. In einer kleineren Umfrage, die im Vereinigten Königreich durchgeführt wurde, nannten 78 Prozent der Eltern die Angst vor Belästigung durch Fremde als Grund, das Spielen ihrer Kinder im Freien einzuschränken, während 52 Prozent Gefahren durch den Straßenverkehr anführten.12
Eine weitere Ursache für den Rückgang des kindlichen Spiels liegt darin, dass dem Schulunterricht und anderen von Erwachsenen geleiteten, schulähnlichen Aktivitäten immer mehr Zeit und Bedeutung beigemessen wird. Kinder verbringen heute mehr Zeit in der Schule, und in der Schule verbringen sie weniger Zeit mit dem Spielen als in der Vergangenheit. Das Schuljahr und der Schultag sind länger geworden, mehr Kinder als früher besuchen akademisch orientierte Kindergärten und Vorschulen, und die Pausenzeiten sind kürzer geworden und in einigen Schulbezirken sogar ganz verschwunden.13
Zunahme der Psychopathologie im Kindes- und Jugendlichenalter
In demselben halben Jahrhundert, in dem das Spielen zurückgegangen ist, hat sich auch die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen verschlechtert. Viele Quellen dokumentieren diesen Rückgang der psychischen Gesundheit, aber die überzeugendsten Beweise – da sie nicht durch Änderungen der Bewertungsmethoden beeinträchtigt werden – stammen aus Analysen standardisierter Bewertungsfragebögen, die über Jahrzehnte hinweg an normativen oder quasi-normativen Populationen junger Menschen in Schulen und Hochschulen durchgeführt worden sind. Jean Twenge von der San Diego State University ist eine der führenden Forscherinnen auf diesem Gebiet. Die folgenden Abschnitte fassen die Beweise aus solchen Studien zusammen, dass Angst, Depression, Gefühle der Hilflosigkeit und Narzissmus bei jungen Menschen in einer scheinbar linearen Weise zugenommen haben, die den Rückgang des Spiels widerzuspiegeln scheint.
Zunahme an Angst und Depression
Forscher verwenden den „Taylor’s Manifest Anxiety Scale“ seit 1952 zur Beurteilung des Angstniveaus von College-Studenten, und eine Version dieses Tests für Kinder (der „Children’s Manifest Anxiety Scale“) wird seit 1956 bei Grundschülern (meist im Alter von neun bis elf Jahren) eingesetzt. Ein anderer, umfangreicherer Fragebogen, das „Minnesota Multiphasic Personality Inventory“ (MMPI), wird seit 1938 bei College-Studenten eingesetzt, und eine Version für Jugendliche (das MMPI-A) wird seit 1951 bei Highschool-Schülern verwendet. Mit dem MMPI und dem MMPI-A werden verschiedene psychologische Probleme und Störungen erfasst, von denen die Depression (aus heutiger Sicht) am eindeutigsten zu interpretieren ist. Alle diese Fragebögen bestehen aus Aussagen über die eigene Person, denen die Person zustimmen oder nicht zustimmen muss. Der „Manifest Anxiety Scale“ von Taylor enthält beispielsweise Aussagen wie „Ich mache mir oft Sorgen, dass etwas Schlimmes passieren wird“ und „Die meiste Zeit fühle ich mich wohl“. In diesem Fall würde ein „Ja“ zur ersten Aussage den Angstwert erhöhen und ein „Ja“ zur zweiten Aussage den Wert verringern.
Twenge und ihre Kollegen haben die Ergebnisse vieler Stichproben junger Menschen in den Vereinigten Staaten im Laufe der Jahrzehnte für alle diese Tests analysiert.14 Die Ergebnisse der Analysen sind bemerkenswert konsistent. Insgesamt zeigen sie, dass die Angst- und Depressionswerte sowie verschiedene andere Indizes für psychische Störungen bei Kindern und College-Studenten seit etwa 1950 bis heute kontinuierlich und dramatisch angestiegen sind. Tatsächlich liegen die jüngsten Werte im Durchschnitt etwa eine volle Standardabweichung über den Werten, die vor etwa fünfzig Jahren ermittelt wurden. Das bedeutet, dass etwa 85 Prozent der jungen Menschen in den jüngsten Stichproben höhere Angst- und Depressionswerte aufweisen als die Durchschnittswerte der gleichen Altersgruppe in den 1950er Jahren. Anders betrachtet zeigen Twenges Analysen der MMPI- und MMPI-A-Werte, dass heute fünf- bis achtmal so viele junge Menschen Werte über dem Grenzwert für eine wahrscheinliche Diagnose einer klinisch bedeutsamen Angst- oder depressiven Störung haben, als dies noch vor einem halben Jahrhundert der Fall war. Auf der Depressionsskala des MMPI beispielsweise lagen etwa 8 Prozent der College-Studenten, die den Test zwischen 2000 und 2007 absolvierten, über dem üblichen Grenzwert für eine klinische Depression, verglichen mit etwa 1 Prozent derjenigen, die den Test zwischen 1938 und 1955 absolvierten.15
In einer von Twenge und ihren Kollegen unabhängig durchgeführten Arbeit analysierten Cassandra Newsom und andere die MMPI- und MMPI-A-Werte von Jugendlichen im Alter von vierzehn bis sechzehn Jahren zwischen 1948 und 1989.16 Ihre Ergebnisse decken sich mit denen von Twenge, und ihr 2003 veröffentlichter Artikel enthält Tabellen, aus denen hervorgeht, wie die Jugendlichen 1948 und 1989 – also in den Jahren, in denen große normative Stichproben getestet wurden – auf bestimmte Items reagierten. Abbildung 1 zeigt zur Veranschaulichung die Ergebnisse für einige der Items, die die größten Veränderungen aufweisen. In jedem Fall steht der Prozentsatz, der der Aussage 1948 zustimmte, an erster Stelle, gefolgt von dem Prozentsatz, der 1989 zustimmte.17
| Aussagen aus MMPI und MMPI-A | Prozentuale Zustimmung 1948 | Prozentuale Zustimmung 1989 |
| „Ich wache morgens frisch und erholt auf“ | 74.6% | 31.3% |
| „Ich arbeite unter großem Druck“ | 16.2% | 41.6% |
| „Das Leben ist für mich die meiste Zeit über eine Belastung“ | 9.5% | 35.0% |
| „Ich habe mehr als genug Probleme, über die ich nachdenken muß“ | 22.6% | 55.2% |
| „Ich habe Angst, meinen Verstand zu verlieren“ | 4.1% | 23.4% |
Die Selbstmordraten sind ein noch ernüchternderer Indikator für den Rückgang der psychischen Gesundheit junger Menschen. Zwischen 1950 und 2005 hat sich die Selbstmordrate bei US-Kindern unter fünfzehn Jahren vervierfacht und bei Menschen zwischen fünfzehn und vierundzwanzig Jahren mehr als verdoppelt. Im gleichen Zeitraum stieg die Selbstmordrate bei Erwachsenen zwischen fünfundzwanzig und vierzig Jahren nur leicht an, während die Rate bei Erwachsenen über vierzig Jahren zurückging.18
Diese Zunahme der Psychopathologie bei Kindern und Jugendlichen scheint nichts mit realistischen Gefahren und Ungewissheiten in der Welt zu tun zu haben. In ihren Analysen fand Twenge keinen Zusammenhang zwischen den Angst- oder Depressionsindizes junger Menschen und Konjunkturzyklen, Kriegen oder anderen nationalen oder weltweiten Ereignissen, von denen manchmal behauptet wird, dass sie die psychische Verfassung junger Menschen beeinflussen. Twenge zufolge waren die Angst- und Depressionsraten bei Kindern und Jugendlichen während der Großen Depression, des Zweiten Weltkriegs, des Kalten Krieges und der turbulenten 1960er und frühen 1970er Jahre weitaus geringer als heute. Die Veränderungen scheinen viel mehr mit der Art und Weise zu tun zu haben, wie junge Menschen die Welt sehen, als mit der Art und Weise, wie die Welt tatsächlich ist.
Geringeres Gefühl der persönlichen Kontrolle
Kliniker wissen mit Sicherheit, dass Ängste und Depressionen stark mit dem Gefühl des Einzelnen korrelieren, die Kontrolle über das eigene Leben zu haben oder nicht zu haben. Diejenigen, die glauben, dass sie ihr Schicksal selbst in der Hand haben, werden viel seltener ängstlich oder depressiv als diejenigen, die glauben, dass sie Opfer von Umständen sind, die sie nicht kontrollieren können. Man könnte meinen, dass das Gefühl der persönlichen Kontrolle in den letzten fünfzig Jahren zugenommen hätte. Bei der Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten sind echte Fortschritte erzielt worden; die alten Vorurteile, die die Möglichkeiten der Menschen aufgrund ihrer Rasse, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Ausrichtung einschränkten, haben abgenommen; und der Durchschnittsbürger ist heute wohlhabender als in den vergangenen Jahrzehnten. Dennoch zeigen die Daten, dass der Glaube junger Menschen, ihr Schicksal selbst in der Hand zu haben, kontinuierlich abgenommen hat.
Das Standardmaß für das Gefühl der persönlichen Kontrolle besteht aus einem Fragebogen, der von Julian Rotter in den späten 1950er Jahren entwickelt wurde und den Namen „Internal-External Locus of Control Scale“ trägt. Er enthält dreiundzwanzig Paare von Aussagen. Eine Aussage in jedem Paar steht für den Glauben an einen internen Kontrollort (Kontrolle durch die Person) und die andere für den Glauben an einen externen Kontrollort (Kontrolle durch Umstände außerhalb der Person). Für jedes Paar muss die Testperson entscheiden, welche der beiden Aussagen wahrer ist. Ein Paar lautet zum Beispiel: „Ich habe festgestellt, dass das, was passieren wird, auch passieren wird“, und „Das Vertrauen in das Schicksal hat sich für mich nie als so gut erwiesen wie die Entscheidung für eine bestimmte Vorgehensweise“. In diesem Fall steht die erste Aussage für einen externen Kontrollort und die zweite für einen internen Kontrollort. Eine Version des Tests für Kinder, die „Children’s Nowicki-Stricklund Internal-External Control Scale“ (CNSIE), wurde erstmals 1971 eingesetzt.
Twenge und ihre Kollegen analysierten die Ergebnisse von Studien, in denen Rotters Skala von 1960 bis 2002 an Gruppen von College-Studenten angewandt wurde, und stellten fest, dass sich die Durchschnittswerte in diesem Zeitraum dramatisch verschoben – weg vom inneren und hin zum äußeren Ende der Skala. Die Verschiebung war so groß, dass der durchschnittliche junge Mensch im Jahr 2002 eher zu den Externen gehörte (er neigte eher dazu, einen Mangel an persönlicher Kontrolle zu behaupten) als 80 Prozent der jungen Menschen in den 1960er Jahren. In einer separaten Untersuchung analysierten die Forscher die Ergebnisse von Studien, die den CNSIE zwischen 1971 und 1998 mit Kindern im Alter von neun bis vierzehn Jahren durchgeführt hatten. Sie fanden heraus, dass der Anstieg der Externalität bei Kindern sogar noch größer war als bei College-Studenten und bei Grundschulkindern größer als bei Mittelschulkindern. Insgesamt verlief die Zunahme der Externalität im Laufe der Jahre im gleichen linearen Trend wie die Zunahme von Depressionen und Angstzuständen.19
Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass die Zunahme des externen Kontrollzentrums ursächlich mit der Zunahme von Ängsten und Depressionen zusammenhängt. Klinische Forscher haben wiederholt – bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen – gezeigt, dass das Gefühl der Hilflosigkeit, das mit einem externen Kontrollzentrum verbunden ist, Menschen für Angst und Depression prädisponiert.20 Wenn Menschen glauben, dass sie wenig oder keine Kontrolle über ihr Schicksal haben, werden sie ängstlich. Sie denken: „Mir kann jederzeit etwas Schreckliches passieren, und ich werde nichts dagegen tun können. Wenn die Angst und das Gefühl der Hilflosigkeit zu groß werden, werden die Menschen depressiv. Sie haben das Gefühl: „Es ist sinnlos, es zu versuchen; ich bin verloren.“ Die Forschung hat auch gezeigt, dass Menschen mit einem externen Kontrollzentrum seltener die Verantwortung für ihre eigene Gesundheit, ihre eigene Zukunft und ihre Gemeinschaft übernehmen als Menschen mit einem internen Kontrollzentrum.21
Zunahme des Narzissmus
Weitere entmutigende Nachrichten kommen aus der Forschung über Narzissmus. Narzissmus bezieht sich auf eine übersteigerte Selbstwahrnehmung, die dazu führt, dass man sich von anderen abgrenzt und die Bildung sinnvoller Beziehungen verhindert. Das „Narcissistic Personality Inventory“ (NPI) wurde in den späten 1970er Jahren entwickelt, um den Narzissmus zu beurteilen, und viele Studien haben seine Gültigkeit nachgewiesen. Personen, die auf dieser Skala hohe Werte erreichen, neigen dazu, andere für ihren persönlichen Vorteil auszubeuten, dazu, Selbsterhöhung über Kooperation zu stellen, begehen mit größerer Wahrscheinlichkeit als andere Wirtschaftsverbrechen, schätzen sich selbst in Bezug auf ihre Führungsqualitäten übermäßig hoch ein und neigen dazu, als Reaktion auf Kritik wütend um sich zu schlagen.22
Twenge und ihre Kollegen analysierten die NPI-Werte von College-Studenten zwischen 1982 und 2007 und stellten fest, dass der Grad des Narzissmus in diesem Fünfundzwanzigjahreszeitraum deutlich und linear anstieg. Das Niveau stieg so stark an, dass 2007 fast 70 Prozent der College-Studenten einen höheren Narzissmuswert aufwiesen als der durchschnittliche College-Student im Jahr 1982.23 Eine weitere Analyse an einer einzigen Universität zeigte, dass sich der Prozentsatz der Studenten, die die meisten NPI-Fragen in narzisstischer Richtung beantworteten, innerhalb von fünfzehn Jahren von 1994 bis 2009 fast verdoppelte (von 18 Prozent auf 34 Prozent).24
Der zunehmende Narzissmus bei jungen Menschen scheint nicht mit der Zunahme von Angstzuständen, Depressionen und dem externen Kontrollzentrum übereinzustimmen, die in denselben Jahren dokumentiert wurden, aber in Wirklichkeit steht er im Einklang mit diesen Veränderungen. Narzissmus wird manchmal als Äquivalent zu einem hohen Selbstwertgefühl beschrieben, aber Kliniker gehen davon aus, dass es sich dabei um eine fragile und defensive Variante des Selbstwertgefühls handelt. Narzissten leiden häufig unter Ängsten und Depressionen, wenn ihre Erfahrungen mit der Realität ihren hohen Selbstbildern zuwiderlaufen.25 Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass Narzissten die mangelnde Übereinstimmung zwischen ihren wahrgenommenen überragenden Qualitäten und ihrem relativen Mangel an Status und Leistung in der Welt auf Faktoren zurückführen, die sich ihrer Kontrolle entziehen, eine Tendenz, die mit einem externen Kontrolltypus übereinstimmt.
Verschiedene andere Fragebögen, die im Laufe der Jahre an Studenten verteilt wurden, haben eine Verschiebung hin zu mehr Materialismus gezeigt, der ein starkes Korrelat von Narzissmus ist. In einer wiederholten Umfrage stieg beispielsweise der Prozentsatz der US-amerikanischen Studienanfänger, die „finanziell sehr gut gestellt zu sein“ zu ihren wichtigsten Zielen zählten, von 46% im Jahr 1967 auf 73% im Jahr 2006. Im gleichen Zeitraum sank der vergleichbare Prozentsatz für die „Entwicklung einer sinnvollen Lebensphilosophie“ von 86 Prozent im Jahr 1967 auf 42 Prozent im Jahr 2006.26 Andere Untersuchungen, die mit einer Verschiebung in Richtung Narzissmus übereinstimmen, zeigen, dass High-School-Schüler heute weitaus unrealistischere Erwartungen in Bezug auf ihre zukünftige Karriere haben als High-School-Schüler früherer Generationen27, und dass Schüler eher betrügen, um gute Noten zu bekommen, als Schüler früherer Generationen.28
Hat der Rückgang des Spielens den Anstieg der Psychopathologie verursacht?
Korrelation ist natürlich kein Beweis für Kausalität. Die Beobachtung, dass Ängste, Depressionen, das Gefühl der Hilflosigkeit und Narzissmus zugenommen haben, während das Spielen abgenommen hat, beweist nicht, dass der Rückgang des Spielens diese psychologischen Veränderungen verursacht hat. Aus logischen Gründen kann jedoch ein starker Beweis für eine solche kausale Rolle erbracht werden. Bevor wir diesen Fall untersuchen, wäre es jedoch sinnvoll, kurz auf Twenges eigene Erklärungen für die zunehmende Psychopathologie einzugehen. Die von ihr vermuteten kausalen Faktoren weisen nicht auf den Rückgang des Spiels hin, sondern beinhalten Veränderungen in der Kultur, die eng mit diesem Rückgang verbunden zu sein scheinen.
Twenges Erklärungen für die Zunahme der Psychopathologie
In einem ihrer Artikel stellt Twenge ein Modell extrinsischer vs. intrinsischer Ziele vor, um den generationenübergreifenden Anstieg der Psychopathologie zu erklären.29 Die Unterscheidung zwischen den beiden Zielkategorien ist nicht scharf oder leicht zu definieren, aber im Allgemeinen sind intrinsische Ziele solche, die Teil der Aktivitäten sind, mit denen sie erreicht werden, oder sehr eng mit ihnen verbunden sind; und extrinsische Ziele sind solche, die eher mit den Aktivitäten verbunden sind, mit denen sie erreicht werden, und die oft als von der Außenwelt auferlegt angesehen werden, anstatt aus dem eigenen Inneren zu stammen. Die Entwicklung von Kompetenz in einer Tätigkeit, die einem Spaß macht, das Schließen von Freundschaften, die Suche nach dem Sinn des Lebens und das Verfolgen eines religiösen Weges, der einem am Herzen liegt, sind Beispiele für intrinsische Ziele. Gute Noten in der Schule zu bekommen, viel Geld zu verdienen, einen hohen Status zu erreichen und vor anderen gut dazustehen sind Beispiele für extrinsische Ziele.
Twenge argumentiert überzeugend, dass in der Kultur im Allgemeinen und bei jungen Menschen im Besonderen eine kontinuierliche Verschiebung weg von intrinsischen hin zu extrinsischen Werten stattgefunden hat, die zum Teil durch die Massenvermarktung von Konsumgütern über das Fernsehen und andere Medien gefördert wird. Sie verweist auch auf Belege dafür, dass die Verfolgung extrinsischer Ziele auf Kosten intrinsischer Ziele mit Ängsten und Depressionen korreliert.30 Dies scheint einleuchtend, da die mit extrinsischen Zielen verbundenen Handlungen per definitionem weniger befriedigend sind als die mit intrinsischen Zielen verbundenen, und die Menschen weniger Kontrolle über das Erreichen extrinsischer Ziele haben als über intrinsische Ziele. Bei intrinsischen Zielen sind die Handlungen und die Ziele im Allgemeinen ein und dasselbe. Bei extrinsischen Zielen werden die Handlungen in der Regel als unangenehme Aufgaben betrachtet, die erledigt werden müssen, um die gewünschten Ziele zu erreichen, und die Verbindung zwischen den Handlungen und den Zielen ist nicht immer sicher.
In einem früheren Artikel über die Zunahme der Angst in den letzten Jahrzehnten hat Twenge die Vermutung geäußert, dass die zunehmende Angst aus der zunehmenden sozialen Isolation und dem geringeren Gemeinschaftsgefühl resultiert.31 Heute leben mehr Menschen allein, und weniger Menschen geben an, enge Vertraute zu haben, als dies früher der Fall war.32 Das Fehlen einer sozialen Unterstützungsgruppe, auf die man sich verlassen kann, ist ein bekannter prädisponierender Faktor für Angst und Depression. Mit der zunehmenden sozialen Isolierung der Familien im Allgemeinen haben sich auch die Kinder zunehmend isoliert. Selbst innerhalb der Familien haben das Verantwortungsgefühl und die soziale Verbundenheit untereinander möglicherweise abgenommen, während der Individualismus zugenommen hat. Diese Vermutung ist durchaus mit Twenges späterem Modell der extrinsischen und intrinsischen Ziele vereinbar, da gemeinschaftliche und familiäre Werte tendenziell mit intrinsischen Zielen übereinstimmen.
Eine allgemeine Verschiebung weg von der gegenseitigen Abhängigkeit und hin zur Unabhängigkeit, eine Zunahme der sozialen Isolation und eine Verschiebung hin zu extrinsischen Werten können ebenfalls dazu beitragen, den Anstieg des Narzissmus zu erklären. Narzissmus wird nämlich durch eine übermäßige Konzentration auf das eigene Ich und eine geringere Konzentration auf die Bedürfnisse anderer definiert. Twenge und ihre Kollegen haben auch die Vermutung geäußert, dass die zunehmende Tendenz der Erwachsenen, Kinder übermäßig zu loben und ihnen zu sagen, wie „wunderbar“ und „besonders“ sie sind, den Narzissmus begünstigt haben könnte.33 Berichte erwachsener Narzissten, wonach ihre Eltern dazu neigten, sie auf ein Podest zu stellen und sie für unbedeutende Leistungen übermäßig zu loben, verstärken den Zusammenhang zwischen elterlichem Lob und Narzissmus.34
Alle von Twenge angeführten Erklärungen für die Entstehung der Psychopathologie erscheinen vernünftig. Sie sind gut dokumentiert und logisch miteinander vereinbar. Es spricht jedoch viel dafür, dass Twenges Erklärungsfaktoren alle in beide Richtungen kausal mit dem Rückgang des Spielens verbunden sind und dass der Rückgang des Spielens möglicherweise der Faktor ist, der den Rückgang der psychischen Gesundheit von Kindern am unmittelbarsten verursacht hat.
Wie das Spielen die psychische Gesundheit von Kindern fördert
Genauer gesagt behaupte ich hier, dass das Spiel Kindern hilft, (a) intrinsische Interessen und Kompetenzen zu entwickeln; (b) zu lernen, wie man Entscheidungen trifft, Probleme löst, Selbstkontrolle ausübt und Regeln befolgt; (c) zu lernen, ihre Emotionen zu regulieren; (d) Freundschaften zu schließen und zu lernen, mit anderen auf Augenhöhe auszukommen; und (e) Freude zu erleben. Durch all diese Effekte fördert das Spielen die psychische Gesundheit.
Im Spiel entwickeln die Kinder intrinsische Interessen und Kompetenzen. Twenge erwähnt das Spiel nicht in ihrer Diskussion, in der sie den Anstieg der Psychopathologie mit dem Rückgang der intrinsischen Ziele in Verbindung bringt. Aber eine Aktivität, die auf intrinsische Ziele ausgerichtet ist, ist fast per Definition ein Spiel. Das Spiel wird in erster Linie um seiner selbst willen betrieben. Eine Welt, die den Wert des kindlichen Spiels anerkennt und es zulässt, ist eine Welt, die sagt: „Ja, es ist in Ordnung, das zu tun, was man tun möchte, es ist in Ordnung, intrinsische Ziele zu verfolgen.“ Eine Welt, die Kinder darauf ausrichtet, Notendurchschnitte und Lebensläufe für eine ungewisse Zukunft zu erstellen, ist eine Welt, die sagt: „Das Leben ist eine lästige Pflicht, du strebst immer nach etwas in der Zukunft; du weißt nicht einmal genau, wonach du strebst oder warum, und du hast keine Garantie, es zu erreichen.“ Letzteres scheint auf den ersten Blick ein perfektes Rezept für Ängste und Depressionen zu sein. In der Schule streben Kinder nach Noten und Lob (extrinsische Ziele), und im Sport, der von Erwachsenen geleitet wird, streben sie nach Lob und Trophäen (extrinsische Ziele) – all das hängt von der Beurteilung durch andere Menschen ab. Beim freien Spiel hingegen tun Kinder das, was sie tun wollen, und das Lernen und das psychologische Wachstum, die sich daraus ergeben, sind Nebenprodukte und keine bewussten Ziele der Aktivität.
Im Spiel lernen Kinder, Entscheidungen zu treffen, Probleme zu lösen, Selbstbeherrschung auszuüben und Regeln zu befolgen. Wenn die Zunahme von Ängsten und Depressionen mit einem Rückgang des Gefühls der persönlichen Kontrolle zusammenhängt, dann scheint das Spiel das perfekte Heilmittel zu sein. Ein grundlegendes Merkmal des Spiels ist, wie bereits erwähnt, dass es von den Spielern selbst geleitet und kontrolliert wird. In der Schule und bei anderen Aktivitäten, die von Erwachsenen geleitet werden, entscheiden Erwachsene, was Kinder tun sollen und wie sie es tun sollen, und Erwachsene lösen die Probleme, die sich ergeben. Im Spiel jedoch müssen die Kinder selbst entscheiden, was sie tun und wie sie es tun sollen, und sie müssen ihre eigenen Probleme lösen, einschließlich derer, die sich innerhalb des Spielrahmens ergeben (z. B. wie man das Monster am besten fängt), und derer, die sich außerhalb des Spielrahmens ergeben (z. B. was man mit Marias aufgeschürften Knien oder Johnnys verlorenen Schuhen macht). Im Spiel lernen die Kinder, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und mit ihrer physischen und sozialen Umgebung umzugehen. Im Spiel lernen und üben sie auch viele der Fähigkeiten, die für das Leben in ihrer Kultur von zentraler Bedeutung sind, und entwickeln dadurch Kompetenz und Selbstvertrauen.35
In einem Aufsatz aus dem Jahr 1933 argumentierte der russische Entwicklungspsychologe Lew Vygotski wortgewaltig, dass ein wichtiger Wert des kindlichen Spiels in der Übung der Selbstkontrolle liegt.36 Er wies darauf hin, dass jedes Spiel Regeln hat und dass die Spieler eine bewusste Kontrolle über ihr eigenes Handeln ausüben müssen, um die Regeln zu befolgen. Die Regeln müssen nicht aufgeschrieben oder gar ausdrücklich genannt werden; sie können intuitiv verstanden werden. Eine Grundregel des Rauf- und Runterspielens verbietet es zum Beispiel, andere Spieler zu verletzen; bei einem Spielkampf macht man einige der Bewegungen eines echten Kampfes nach, aber man tritt, beißt, schlägt oder kratzt nicht. Wenn Sie der Stärkere von beiden sind, schubsen oder schlagen Sie nicht mit voller Wucht. Im soziodramatischen Spiel müssen Sie in Ihrer Rolle bleiben: Wenn du Supermann bist, darfst du nicht weinen, wenn du fällst und dich verletzt; und wenn du der Haushund bist, musst du auf allen Vieren herumlaufen, egal wie unangenehm es ist. Vygotsky wies darauf hin, dass der starke Wunsch der Kinder, zu spielen und das Spiel in Gang zu halten, sie dazu bringt, Einschränkungen ihres Verhaltens zu akzeptieren, die sie im wirklichen Leben nicht akzeptieren würden. Sie lernen im Spiel, dass Selbstbeherrschung selbst eine Quelle der Freude ist.
Es macht durchaus Sinn, dass Spielentzug zu einem externen Kontrollzentrum führen würde. Kinder, die nicht die Möglichkeit haben, ihre eigenen Handlungen zu kontrollieren, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen, ihre eigenen Probleme zu lösen und zu lernen, wie man Regeln im Spiel befolgt, wachsen mit dem Gefühl auf, dass sie keine Kontrolle über ihr eigenes Leben und Schicksal haben. Sie wachsen mit dem Gefühl auf, vom Glück und vom Wohlwollen und den Launen anderer abhängig zu sein – ein beängstigendes Gefühl, wenn man weiß, dass das Glück in beide Richtungen geht und dass man sich nicht immer auf andere verlassen kann.
Im Spiel lernen Kinder, ihre Gefühle zu regulieren. Forschungen über das Spiel von Tieren haben zu der Theorie geführt, dass junge Säugetiere durch das Spiel lernen, mit dem Unerwarteten umzugehen.37 Beim motorischen Spiel und beim Toben scheinen sich junge Säugetiere absichtlich in unangenehme, mäßig beängstigende Situationen zu begeben. Während sie spielerisch galoppieren, springen, sich in Bäumen hin und her schwingen (wenn es sich um Primaten handelt) und sich gegenseitig jagen, verlieren sie ständig abwechselnd die Kontrolle über ihre Körperbewegungen und gewinnen sie wieder zurück. Wenn sie zum Beispiel springen, drehen sie sich so, dass es schwierig ist, zu landen. Es scheint, als würden sie sich selbst mit einem moderaten Maß an Angst dosieren, als würden sie bewusst lernen, mit den körperlichen und emotionalen Herausforderungen der mäßig gefährlichen Bedingungen, die sie erzeugen, umzugehen. Bei ihren spielerischen Kämpfen, zumindest bei jungen Ratten, scheint jedes Tier die untergeordnete Position zu bevorzugen, die wiederum sowohl die größte emotionale als auch physische Herausforderung darstellt.38 Sie verletzen sich selbst so, dass ihr Spielkamerad in die Angriffsposition, die obere Position, gelangen kann, und dann kämpfen sie, um sich zu erholen. Aufschlussreich sind Experimente, in denen jungen Rhesusaffen oder Ratten das Spiel entzogen wurde. Wurden diesen Tieren in einer kritischen Phase ihrer Entwicklung Spielkameraden vorenthalten, so reagierten sie später emotional übermäßig auf Stresssituationen und waren aus diesem Grund nicht in der Lage, diese adaptiv zu bewältigen. Sie zeigten sowohl übermäßige Angst als auch unangemessene Aggression.39
Selbst zufällige Beobachtungen von Kindern, die im Freien spielen, bestätigen, dass sich diese Kinder, wie andere junge Säugetiere auch, beim Spielen absichtlich in eine Situation begeben, die mäßig Angst auslöst. Ihr Schwingen, Rutschen und Herumwirbeln auf Spielplatzgeräten, ihr Klettern auf Kletterstangen oder Bäumen, ihr waghalsiges Skateboardfahren über Geländer – all diese Aktivitäten machen in dem Maße Spaß, wie sie mäßig angstauslösend sind. Wird zu wenig Angst ausgelöst, ist die Aktivität langweilig; wird zu viel Angst ausgelöst, wird sie nicht mehr zum Spiel, sondern zum Schrecken. Niemand außer dem Kind selbst kennt die richtige Dosis, weshalb alle diese Spiele selbstgesteuert und selbstkontrolliert sein müssen. Neben den körperlich herausfordernden Situationen bringen sich Kinder auch in ihrem sozialen Spiel in sozial herausfordernde Situationen. Alle Arten von sozialem Spiel können sowohl zu Konflikten als auch zu Kooperation führen; und um weiterspielen zu können, müssen Kinder lernen, die Emotionen, insbesondere Wut und Angst, zu kontrollieren, die solche Konflikte auslösen können.40
Eine verminderte Fähigkeit zur Emotionsregulierung, die auf Spielentzug zurückzuführen ist, kann durchaus zu den hohen Raten von Psychopathologie bei jungen Menschen heutzutage beitragen. Personen, die unter Angststörungen leiden, beschreiben den Verlust der emotionalen Kontrolle als eine ihrer größten Ängste.41 Sie haben Angst vor ihrer eigenen Angst, und daher führen kleine Angstausbrüche, die durch leicht bedrohliche Situationen hervorgerufen werden, zu großen Angstausbrüchen, die durch die Angst der Person vor Kontrollverlust hervorgerufen werden. Die Forschung zeigt, dass hochgradig ängstliche Kinder ebenso wie hochgradig ängstliche Erwachsene in Fragebögen, die den Grad ihrer Überzeugung, ihre eigenen Angstreaktionen auf mäßig herausfordernde Situationen kontrollieren zu können, bewerten, schlecht abschneiden.42 Andere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Unfähigkeit, Wut in Konflikten mit anderen Menschen zu kontrollieren, sowohl in der Kindheit als auch im Erwachsenenalter, ein wesentlicher Bestandteil der Unfähigkeit von Narzissten ist, positive, intime, soziale Beziehungen aufzubauen.43
Im Spiel schließen Kinder Freundschaften und lernen, mit anderen auf Augenhöhe auszukommen. Wie bereits erwähnt, führt Twenge die generationsbedingte Zunahme von Angstzuständen und Depressionen teilweise auf die zunehmende soziale Isolation in unserer Kultur zurück. Aber das Spiel ist das natürliche Mittel der Kinder, um Freunde zu finden. Es ist das, was sie anzieht und zusammenschweißt. Selbst unter Erwachsenen fördert und nährt eine spielerische, auf intrinsische Ziele ausgerichtete Haltung Freundschaften. Der Rückgang des Spielens kann sowohl eine Folge als auch eine Ursache für die zunehmende soziale Isolation und Einsamkeit in unserer Kultur sein.
Das soziale Spiel scheint auch das beste Mittel zu sein, um die mit Narzissmus verbundenen Überlegenheitsgefühle zu bekämpfen. Eltern mögen ihre Kinder auf ein Podest stellen und ihnen sagen, wie besonders sie sind, und Lehrer mögen übermäßiges Lob und hohe Noten für mittelmäßige Leistungen geben, aber Kinder selbst überschätzen sich in ihrem Spiel nicht. Im Spiel dulden Kinder keine Überheblichkeit oder Forderungen nach besonderer Behandlung und besonderen Regeln.
Das soziale Spiel ist von Natur aus eine egalitäre Aktivität. Ein grundlegendes Merkmal des Spiels ist, dass es freiwillig ist; die Spieler können jederzeit aufhören, und jeder Spieler, der sich von den anderen gemobbt oder herabgesetzt fühlt, wird aufhören. Um das Spiel aufrechtzuerhalten – ob es sich nun um eine wilde Schlägerei, ein soziodramatisches Fantasiespiel oder ein Baseballspiel handelt – ist es wichtig, die anderen Spieler bei Laune zu halten, oder zumindest so zufrieden, dass sie nicht aufgeben. Die Regeln müssen so ausgehandelt werden, dass sie von allen akzeptiert werden – oder diejenigen, die nicht einverstanden sind, gehen. Und während des Spiels muss jeder Spieler auf die emotionalen Reaktionen und Bedürfnisse der anderen achten, denn jeder, der sich zu sehr aufregt, verlässt das Spiel. Wenn zu viele gehen, ist das Spiel zu Ende. Kinder wollen von Natur aus mit anderen Kindern spielen, aber um dies erfolgreich zu tun, müssen sie lernen und üben, wie sie mit anderen gleichberechtigt auskommen können.
An anderer Stelle habe ich argumentiert, dass das Erlernen des Zusammenlebens und der gleichberechtigten Zusammenarbeit mit anderen die wichtigste evolutionäre Funktion des menschlichen Sozialspiels sein könnte.44 Das Spiel – sowohl in der Kindheit als auch im Erwachsenenalter – scheint das wichtigste Mittel gewesen zu sein, mit dem unsere Jäger- und Sammler-Vorfahren egoistische Tendenzen überwunden und in einer höchst kooperativen, egalitären Weise gelebt haben, die für ihr Überleben unerlässlich war. Das soziale Spiel ist ein Mittel der Natur, um jungen Menschen beizubringen, dass sie nichts Besonderes sind. Selbst diejenigen, die bei den Aktionen des Spiels geschickter sind als die anderen Spieler, müssen die Bedürfnisse und Wünsche der anderen als gleichwertig mit ihren eigenen betrachten, sonst werden sie von den anderen ausgeschlossen. Manche Kinder brauchen viel mehr Übung als andere, um diese Lektionen zu lernen, und das sind vielleicht diejenigen, die in Ermangelung vieler Gelegenheiten zum sozialen Spiel zu Narzissten heranwachsen.
Soziales Spiel macht Kinder glücklich, und sein Fehlen macht sie unglücklich. Die vielleicht einfachste Erklärung für die Zunahme von Depressionen und Angstzuständen bei Kindern und Jugendlichen ist, dass wir sie als Gesellschaft zunehmend in Umgebungen gezwungen haben, die sie unglücklich und ängstlich machen, und sie der Aktivitäten beraubt haben, die sie glücklich machen. Vor einigen Jahren führten Mihaly Csikszentmihalyi und Jeremy Hunter eine Studie über Glück und Unglücklichsein bei Schülern öffentlicher Schulen der sechsten bis zwölften Klasse durch.45 Eine Woche lang trugen mehr als achthundert Teilnehmer aus dreiunddreißig Schulen in zwölf Gemeinden im ganzen Land spezielle Armbanduhren, die so programmiert waren, dass sie zu zufälligen Zeiten zwischen 7.30 und 22.30 Uhr Signale abgaben. Immer wenn das Signal ertönte, füllten die Teilnehmer einen Fragebogen aus, in dem sie angaben, wo sie sich befanden, was sie gerade taten und wie glücklich oder unglücklich sie gerade waren. Die Kinder waren bei weitem am unglücklichsten, wenn sie in der Schule waren oder Hausaufgaben machten, und am glücklichsten, wenn sie nicht in der Schule waren und sich unterhielten oder mit Freunden spielten. Die Zeit, die sie mit ihren Eltern verbrachten, und die Zeit, die sie allein mit Freizeitaktivitäten wie Fernsehen verbrachten, lagen in der Mitte der Glücklich-unglücklich-Spanne. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit anderen Forschungsergebnissen, die bereits in diesem Artikel zitiert wurden und aus denen hervorgeht, dass Kinder beim sozialen Spiel mit Freunden im Durchschnitt glücklicher sind als in jeder anderen Situation.
Irgendwie sind wir als Gesellschaft zu dem Schluss gekommen, dass wir, um Kinder vor Gefahren zu schützen und sie zu erziehen, ihnen genau die Aktivitäten vorenthalten müssen, die sie am glücklichsten machen, und sie für immer mehr Stunden in Umgebungen unterbringen müssen, in denen sie mehr oder weniger ständig von Erwachsenen gelenkt und bewertet werden. Umgebungen, die geradezu darauf ausgelegt sind, Angst und Depression zu erzeugen. Wenn wir wollen, dass Kinder glücklich sind und zu sozial und emotional erfüllten und kompetenten Erwachsenen heranwachsen, müssen wir ihnen wieder die Möglichkeit geben, viele Stunden am Tag frei mit Freunden zu spielen.
Abschließende Überlegungen
Dieser Artikel hat den Rückgang des Spielens und die Zunahme der Psychopathologie bei jungen Menschen in den letzten Jahrzehnten dokumentiert und Gründe für die Annahme beschrieben, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen beiden gibt. Das Spiel, insbesondere das soziale Spiel mit anderen Kindern, erfüllt eine Vielzahl von Entwicklungsfunktionen, die alle die psychische Gesundheit von Kindern fördern. Fehlt ein solches Spiel, erwerben Kinder nicht die sozialen und emotionalen Fähigkeiten, die für eine gesunde psychische Entwicklung unerlässlich sind.
In diesem Artikel wurden die lähmenden Auswirkungen des Spielmangels nur selektiv beschrieben. Er hat sich auf Angst, Depression, Gefühle der Hilflosigkeit und Narzissmus konzentriert. Der dramatische Anstieg der Fettleibigkeit bei Kindern und der Rückgang der allgemeinen körperlichen Fitness, den andere zumindest teilweise auf den Rückgang des Spielens im Freien zurückführen, wurde bisher nicht erwähnt.46 Andere haben auch argumentiert, dass die hohe Rate von ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) zumindest teilweise auf den Rückgang des intensiven Spielens im Freien zurückzuführen sein könnte.47 Diesem Argument könnte man hinzufügen, dass das Erlernen von Selbstkontrolle und emotionaler Regulierung, das durch alle Formen des sozialen Spiels hervorgerufen wird, ein perfektes Gegengewicht zu der Impulsivität, der Hyperaktivität und dem Mangel an emotionaler Kontrolle zu sein scheint, die für ADHS charakteristisch sind.
In einem Aufsatz, den US-Außenministerin Hillary Clinton über ihr eigenes freudiges und bedeutungsvolles Kindheitsspiel schrieb, kam sie zu dem Schluss: „Wir waren so unabhängig, uns wurde so viel Freiheit gewährt. Aber es ist unmöglich, sich vorzustellen, dass man das heute einem Kind geben kann. Das ist einer der großen Verluste für unsere Gesellschaft. Aber ich hoffe, dass wir die Freude und die Erfahrung des freien Spiels und der Spiele in der Nachbarschaft zurückgewinnen können, die in meiner Generation als selbstverständlich galten. Das wäre eines der besten Geschenke, die wir unseren Kindern machen könnten.“48 Wenn die in diesem Artikel dargelegten Beweise und Überlegungen zutreffen, dann ist die Wiederherstellung des freien Spiels der Kinder nicht nur das beste Geschenk, das wir unseren Kindern machen können, sondern auch ein wesentliches Geschenk, wenn wir wollen, dass sie zu psychisch gesunden und emotional kompetenten Erwachsenen heranwachsen.
Fußnoten
- Yumi Gosso, Emma Otta, Maria de Lima Salum e Morais, Fernando Ribeiro, and Vera Bussab, “Play in Hunter-Gatherer Society,” in The Nature of Play: Great Apes and Humans, ed. Anthony D. Pellegrini and Peter K. Smith (2005), 213–53; Peter Gray, “Play as a Foundation for Hunter-Gatherer Social Existence,” American Journal of Play 1 (2009): 476–522.
- What I am here calling free play is in some writings called simply play, as the selfdirected component is considered to be part of play’s definition. For a more thorough discussion of play’s definition, see Gray, “Play as a Foundation for Hunter-Gatherer Social Existence,” 479–484.
- Howard P. Chudacoff, Children at Play: An American History (2007).
- Joe L. Frost, A History of Children’s Play and Play Environments: Toward a Contemporary Child-Saving Movement (2010); Steven Mintz, Huck’s Raft: A History of American Childhood (2004).
- Sandra L. Hofferth and John F. Sandberg, “Changes in American Children’s Time, 1981–1997,” in Children at the Millennium: Where Have We Come From? Where Are We Going? Advances in Life Course Research, vol. 6, ed. Timothy Owens and Sandra L.Hofferth (2001): 193–229.
- Rhonda Clements, “An Investigation of the Status of Outdoor Play,” Contemporary Issues in Early Childhood 5 (2004): 68–80.
- Reported by Jonathon O’Brien and Jenny Smith, “Childhood Transformed? Risk Perception and the Decline of Free Play,” The British Journal of Occupational Therapy 65 (2002): 123–28.
- Dorothy G. Singer, Jerome L. Singer, Heidi D’Agostino, and Raeka DeLong, “Children’s Pastimes and Play in Sixteen Nations: Is Free-Play Declining?” American Journal of Play 1 (2009): 283–312.
- Family Kids and Youth, Playreport: International Summary of Research Results (2010), published online, available at www.fairplayforchildren.org/pdf/1280152791.pdf. This survey was sponsored by IKEA and was overseen by Barbie Clarke, CEO of the marketing research group Family Kids and Youth.
- David Finkelhor, Heather Turner, Richard Ormrod, and Sherry L. Hamby, “Trends in Childhood Violence and Abuse Exposure: Evidence from 2 National Surveys,” Archives of Pediatric and Adolescent Medicine 164 (2010): 238–42.
- Family Kids and Youth, Playreport.
- See Clements, “An Investigation of the Status of Outdoor Play,” 123.
- Frost, “A History of Children’s Play,” 199–200, 230–35.
- Jean M. Twenge, “The Age of Anxiety? The Birth Cohort Change in Anxiety and Neuroticism, 1952–1993,” Journal of Personality and Social Psychology 79 (2000): 1007–21. Jean M. Twenge, Brittany Gentile, C. Nathan DeWall, Debbie Ma, Katharine Lacefield, and David R. Schurtz, “Birth Cohort Increases in Psychopathology Among Young Americans, 1938–2007: A Cross-Temporal Meta Analysis of the MMPI,” Clinical Psychology Review 30 (2010): 145–54.
- Twenge et al., “Birth Cohort Increases in Psychopathology Among Young Americans, 1938–2007,” 150.
- Cassandra Rutledge Newsom, Robert P. Archer, Susan Trumbetta, and Irving I. Gottesman, “Changes in Adolescent Response Patterns on the MMPI/MMPI-A Across Four Decades,” Journal of Personality Assessment 81 (2003): 74–84.
- Data are from tables 4 and 5 of Newsom et al., “Changes in Adolescent Response Patterns on the MMPI/MMPI-A Across Four Decades.” Because the scores for boys and girls on these items were similar and changed in similar ways, I have summarized the results by averaging the scores for the two sexes.
- According to records kept by the Center for Disease Control, suicide rates among children and adolescents rose steeply between 1950 and approximately 1995; then they declined slightly until 2003, apparently because of greater awareness and the development of programs aimed at preventing childhood suicide. More recent reports, however, indicate that adolescent and childhood suicide rates have been rising, again, since
- For rates by age group from 1950 to 2005, see http://www.infoplease.com/ipa/ A0779940.html#axzz0zVy5PKaL. For an example of a report of increased suicide since 2003, see Rick Nauert, “Teen Suicide Rates Remain High,” at http://psychcentral.com/news/2008/09/04/teen suicide-rates-remain-high/2874.html (2008).
- Jean M. Twenge, Liqing Zhang, and Charles Im, “It’s Beyond My Control: A Cross- Temporal Meta Analysis of Increasing Externality in Locus of Control, 1960–2002,” Personality and Social Psychology Review 8 (2004): 308–19.
- For evidence supporting a causal link between a helpless style of thinking and depression, see Lyn Y. Abramson, Gerald I. Metalsky, and Lauren B. Alloy, “Hopelessness Depression: A Theory-Based Subtype of Depression,” Psychological Review 96 (1989): 358–72; and Lauren B. Alloy, Lyn Y. Abramson, Wayne G. Whitehouse, Michel E. Hogan, Catherine Panzarella, and Donna T. Rose, “Prospective Incidence of First Onsets and Recurrences of Depression in Individuals at High and Low Cognitive Risk for Depression,” Journal of Abnormal Psychology 115 (2006): 145–56. For evidence of a relation between external locus of control and anxiety in children, see Ho Cheung William Li and Oi Kwan Joyce Chung, “The Relationship Between Children’s Locus of Control and Their Anticipatory Anxiety, Public Health Nursing 26 (2009): 153–60; and Carl F.
- Weems and Wendy K. Silverman, “An Integrative Model of Control: Implications for
- Understanding Emotion Regulation and Dysregulation in Childhood Anxiety,” Journal
- of Affective Disorders 91 (2006): 113–24.
- For references to such research see Twenge, “It’s Beyond My Control”; and John W. Reich, Kristi J. Erdal, and Alex J. Zautra, “Beliefs about Control and Health Behaviors,” in Handbook of Health Behavior Research, vol. 1, Personal and Social Determinants, ed. David S. Gochman (1997): 93–111.
- W. Keith Campbell, Carrie Pierce Bush, Amy B. Brunell, and Jeremy Shelton, “Understanding the Social Costs of Narcissism: The Case of the Tragedy of the Commons,” Personality and Social Psychology Bulletin 31 (2005): 1358–68; Timothy A. Judge, Jeffrey A. LePine, and Bruce L. Rich, “Loving Yourself Abundantly: Relationship of the Narcissistic Personality to Self- and Other Perceptions of Workplace Deviance, Leadership, and Task and Contextual Performance,” Journal of Applied Psychology 91 (2006): 762–76; Sander Thomaes, Brad J. Bushman, Brad Orobio de Castro, and Hedy Stegge, “What Makes Narcissists Bloom? A Framework for Research on the Etiology and Development of Narcisissm,” Development and Psychopathology 21 (2009): 1233–47; Gerhard Blickle, Alexander Schlegel, Pantaleon Fassbender, and Uwe Klein, “Some Personality Correlates of Business White Collar Crime,” Applied Psychology 55 (2006): 220–33.
- Jean M. Twenge and Joshua D. Foster, “Birth Cohort Increases in Narcissistic Personality Traits Among American College Students, 1982–2009,” Social Psychological and Personality Science 1 (2010): 99–106; Jean M. Twenge, “Egos Inflating Over Time: A Cross-Temporal Meta-Analysis of the Narcissistic Personality Inventory,” Journal of Personality 76 (2008): 875–901.
- Twenge and Foster, “Birth Cohort Increases in Narcissistic Personality Traits,” 102.
- Shona M. Tritt, Andrew G. Ryder, Angela J. Ring, and Aaron Pincus, “Pathological Narcissism and the Depressive Temperament,” Journal of Affective Disorders 122 (2010): 280–84.
- John H. Pryor, Sylvia Hurtado, Victore B. Saenz, Jos Luis Santos, and William S. Korn, The American Freshman: Forty Year Trends, 1966–2006 (2007): 32. The steepest rates of changes in these two life goals occurred between 1967 and 1987; then the slopes leveled off, and the percentages remained relatively constant from year to year.
- John Reynolds, Michael Stewart, Ryan Macdonald, and Lacey Sischo, “Have Adolescents Become too Ambitious? High School Seniors’ Educational and Occupational Plans, 1976–2000,” Social Problems 53 (2006): 186–206.
- Fred Schab, “Schooling Without Learning: Thirty Years of Cheating in High School,” Adolescence 26 (1991): 839–48; Joan Oleck, “Most High-School Students Admit to Cheating,” School Library Journal (March 10, 2008), http://www.schoollibraryjournal.com/article/CA6539855.html
- Twenge, “Birth Cohort Increases in Psychopathology,” 146–47.
- Tim Kasser, The High Price of Materialism (2002); Tim Kasser and Richard M. Ryan, “Further Examining the American Dream: Differential Correlates of Intrinsic and Extrinsic Goals,” Personality and Social Psychology Bulletin 22 (1996): 280–87.
- Twenge, “The Age of Anxiety?” 109, 117–18.
- Miller McPherson, Lynn Smith-Lovin, and Matthew E. Brashears, “Social Isolation in America: Changes in Core Discussion Networks over Two Decades,” American Sociological Review 71 (2006): 353–75.
- Twenge et al., “Egos Inflating Over Time,” 892–93.
- Lorna J. Otway and Vivian L. Vignoles, “Narcissism and Childhood Recollections: A Qualitative Test of Psychoanalytic Predictions,” Personality and Social Psychology Bulletin 32 (2006): 104–16; Thomaes et al., “What Makes Narcissists Bloom?” 1233–47.
- Peter Gray, “The Evolutionary Biology of Education: How Our Hunter-Gatherer Educative Instincts Could Form the Basis for Education Today,” Evolution: Education, and Outreach (2011), in press; Peter Gray, “The Special Value of Children’s Age-Mixed Play,” American Journal of Play 3 (2011): 500–22.
- Lev Vygotsky, “The Role of Play in Development,” in Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes, ed. Michael Cole, Vera John-Steiner, Sylvia Scribner, and Ellen Souberman (1978): 92–104.
- Marek Spinka, Ruth C. Newberry, and Marc Bekoff, “Mammalian Play: Training for the Unexpected,” Quarterly Review of Biology 76 (2001): 141–68.
- Sergio M. Pellis, Vivien C. Pellis, and Heather C. Bell, “The Function of Play in the Development of the Social Brain,” American Journal of Play 2 (2010): 278–96.
- For reviews of such play-deprivation research, see Peter LaFreniere, “Evolutionary Functions of Social Play: Life Histories, Sex Differences, and Emotion Regulation,” American Journal of Play 3(2011), 464–88; and Pellis et al., “The Function of Play in the Development of the Social Brain,” 278–96.
- LaFreniere, “Evolutionary Functions of Social Play,” American Journal of Play 3(2011), 464–88 .
- David H. Barlow. Anxiety and Its Disorders: The Nature and Treatment of Anxiety and Panic, 2nd ed. (2002).
- Sanne M. Hogendoorn, Lidewij H. Wolters, Leentje Vervoort, Pier J. M. Prins, Frits Boer, and Else de Haan, “An Indirect and Direct Measure of Anxiety-Related Perceived Control in Children: The Implicit Association Procedure (IAP) and Anxiety Control Questionnaire for Children (ACQ-C),” Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 39 (2008): 436–50; Carl F. Weems and Wendy K. Silverman, “An Integrative Model of Control: Implications for Understanding Emotion Regulation and Dysregulation in Childhood Anxiety,” Journal of Affective Disorders 91 (2006): 113–24.
- Kevin S. Carlson and Per F. Gjerde, “Preschool Personality Antecedents of Narcissism in Adolescence and Young Adulthood: A 20-Year Longitudinal Study,” Journal of Research in Personality 43 (2009): 570–78; Thomaes et al., “What Makes Narcissists Bloom?” 1233–47.
- Gray, “Play as a Foundation for Hunter-Gatherer Social Existence,” 476–522.
- Mihaly Csikszentmihalyi and Jeremy Hunter, “Happiness in Everyday Life: The Uses of Experience Sampling,” Journal of Happiness Studies 4 (2003): 185–99.
- See chapter 8, “The Value of Play and the Consequences of Play Deprivation,” in Frost, A History of Children’s Play and Play Environments, 198–236.
- Jaak Panksepp, “Can PLAY Diminish ADHD and Facilitate the Construction of the Social Brain?” Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry 16 (2007): 57– 66; Jaak Panksepp, Jeff Burgdorf, Cortney Turner, and Nakia Gordon, “Modeling ADHD-Type Arousal with Unilateral Frontal Cortex Damage in Rats and Beneficial Effects of Play Therapy,” Brain and Cognition, 52 (2003): 97–105.
- Clinton, Hillary R., “An Idyllic Childhood,” in The Games We Played: A Celebration of Childhood and Imagination, ed. Steven A. Cohen (2001), 161–65. View publication