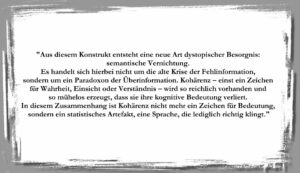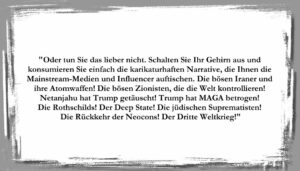Die Torheit des Szientismus – Austin L. Hughes
Warum Wissenschaftler nicht in die Domäne der Philosophie eindringen sollten.
Quelle: The Folly of Scientism
Als ich mich für eine wissenschaftliche Laufbahn entschied, war eines der Dinge, die mich an der Wissenschaft ansprachen, die Bescheidenheit derer, die sie betreiben. Der typische Wissenschaftler schien eine Person zu sein, die eine kleine Ecke der natürlichen Welt kannte und sie sehr gut kannte, besser als die meisten anderen lebenden Menschen und sogar besser als die meisten, die jemals gelebt hatten. Außerhalb ihres begrenzten Fachgebiets zögerten die Wissenschaftler jedoch, eine verbindliche Meinung zu äußern. Diese Haltung war gerade deshalb attraktiv, weil sie in scharfem Kontrast zur Arroganz der Philosophen der positivistischen Tradition stand, die für die Wissenschaft und ihre Praktiker eine umfassende Autorität beanspruchten, mit der viele praktizierende Wissenschaftler selbst nicht einverstanden waren.
Der Versuchung, zu weit zu gehen, scheint man jedoch heute in Diskussionen über die Wissenschaft zunehmend nachzugeben. Sowohl in der Arbeit von Berufsphilosophen als auch in populären Schriften von Naturwissenschaftlern wird häufig behauptet, dass die Naturwissenschaft den gesamten Bereich der Wahrheit ausmacht oder bald ausmachen wird. Und auch unter den Wissenschaftlern selbst ist diese Einstellung immer weiter verbreitet. Allzu viele meiner Zeitgenossen in der Wissenschaft haben den Hype unhinterfragt akzeptiert, der suggeriert, ein fortgeschrittener Abschluss in irgendeinem Bereich der Naturwissenschaft verleihe die Fähigkeit, weise über jedes Thema zu pontifizieren.
Natürlich gab es seit den Anfängen des modernen Wissenschaftsbetriebs Wissenschaftler und Philosophen, die von der Fähigkeit der Naturwissenschaften zum Erkenntnisgewinn so beeindruckt waren, dass sie behaupteten, diese Wissenschaften seien der einzig gültige Weg, um auf jedem Gebiet nach Wissen zu suchen. Ein unverblümter Ausdruck dieses Standpunkts ist der Chemiker Peter Atkins, der in seinem 1995 erschienenen Essay „Science as Truth“ die „universelle Kompetenz“ der Wissenschaft behauptet. Diese Position wird als Szientismus bezeichnet – ein Begriff, der ursprünglich abwertend gemeint war, von einigen seiner lautstarken Befürworter jedoch als Ehrenabzeichen verwendet wird. In ihrem 2007 erschienenen Buch „Every Thing Must Go: Metaphysics Naturalized“ zum Beispiel gehen die Philosophen James Ladyman, Don Ross und David Spurrett so weit, ein Kapitel „In Defense of Scientism“ zu betiteln.
Die moderne Wissenschaft wird oft so beschrieben, als sei sie aus der Philosophie hervorgegangen; viele der frühen modernen Wissenschaftler beschäftigten sich mit dem, was sie „Naturphilosophie“ nannten. Später wurde die Philosophie als eine Tätigkeit angesehen, die sich von der Naturwissenschaft unterscheidet, aber mit ihr zusammenhängt, wobei beide getrennte, aber sich ergänzende Fragen behandeln und sich gegenseitig unterstützen, korrigieren und mit Wissen versorgen. Aber der Status der Philosophie hat sich in letzter Zeit ziemlich verschlechtert. Im Mittelpunkt des Szientismus steht die Vereinnahmung fast des gesamten Gebiets dessen, was einst als Fragen betrachtet wurde, die eigentlich in die Philosophie gehören. Der Szientismus geht davon aus, dass die Wissenschaft bei der Beantwortung solcher Fragen nicht nur besser ist als die Philosophie, sondern auch das einzige Mittel, um sie zu beantworten. Für die meisten, die sich mit dem Szientismus befassen, ist dieser Wandel unbewusst und wird vielleicht nicht einmal erkannt. Aber für andere ist er eindeutig. Atkins zum Beispiel lehnt den gesamten Bereich in vernichtender Weise ab: „Ich halte es für eine vertretbare Behauptung, dass kein Philosoph dazu beigetragen hat, die Natur zu erhellen; die Philosophie ist nur die Verfeinerung von Hemmnissen.“
Ist der Szientismus vertretbar? Ist es wirklich wahr, dass die Naturwissenschaft eine zufriedenstellende und einigermaßen vollständige Erklärung für alles liefert, was wir sehen, erfahren und zu verstehen versuchen – für jedes Phänomen im Universum? Und stimmt es, dass die Wissenschaft besser, ja sogar in einzigartiger Weise in der Lage ist, die Fragen zu beantworten, die einst von der Philosophie behandelt wurden? Dieses Thema ist zu umfangreich, um es auf einmal zu behandeln. Aber wenn wir uns kurz mit dem modernen Verständnis von Wissenschaft und Philosophie befassen, auf dem der Szientismus beruht, und einige Fallstudien über den Versuch untersuchen, die Philosophie vollständig durch die Wissenschaft zu ersetzen, bekommen wir vielleicht ein Gefühl dafür, wie der Szientismus seine Kompetenzen überschreitet.
Die Abdankung der Philosophen
Wenn man die Philosophie als eine legitime und notwendige Disziplin betrachtet, dann könnte man meinen, dass ein gewisses Maß an philosophischer Ausbildung für einen Wissenschaftler sehr nützlich wäre. Wissenschaftler sollten in der Lage sein zu erkennen, wie oft philosophische Fragen bei ihrer Arbeit auftauchen – d.h. Fragen, die nicht durch Argumente gelöst werden können, die sich ausschließlich auf Schlussfolgerungen und empirische Beobachtungen stützen. In den meisten Fällen entstehen diese Fragen, weil praktizierende Wissenschaftler – wie alle Menschen – zu philosophischen Fehlern neigen. Um ein offensichtliches Beispiel zu nennen: Wissenschaftler neigen zu elementaren logischen Fehlern, die im Peer-Review-Verfahren oft unentdeckt bleiben und große Auswirkungen auf die Fachliteratur haben können – zum Beispiel die Verwechslung von Korrelation und Kausalität oder die Verwechslung von Implikation und Bikonditionalität. Die Philosophie kann einen Weg bieten, solche Fehler zu verstehen und zu korrigieren. Sie befasst sich mit einer Reihe von Fragen, die die Naturwissenschaft allein nicht beantworten kann, die aber beantwortet werden müssen, damit die Naturwissenschaft richtig betrieben werden kann.
Zu diesen Fragen gehört, wie wir die Wissenschaft selbst definieren und verstehen. Eine Gruppe von Wissenschaftstheorien – diejenigen, die eine klare Unterscheidung zwischen Wissenschaft und Philosophie und eine notwendige Rolle für beide am besten unterstützen – kann im Großen und Ganzen als „essentialistisch“ eingestuft werden. Diese Theorien versuchen, die wesentlichen Merkmale zu identifizieren, die die Wissenschaft von anderen menschlichen Aktivitäten unterscheiden oder die wahre Wissenschaft von nicht-wissenschaftlichen und pseudowissenschaftlichen Formen der Forschung. Zu den einflussreichsten und überzeugendsten dieser Theorien gehört Karl Poppers Kriterium der Falsifizierbarkeit, das er in „The Logic of Scientific Discovery“ (1959) dargelegt hat.
Eine falsifizierbare Theorie ist eine Theorie, die eine bestimmte Vorhersage darüber macht, welche Ergebnisse unter bestimmten Versuchsbedingungen eintreten sollen, so dass die Theorie durch die Durchführung des Experiments und den Vergleich der vorhergesagten mit den tatsächlichen Ergebnissen falsifiziert werden kann. Eine Theorie oder Erklärung, die nicht falsifizierbar ist, fällt nicht in den Bereich der Wissenschaft. Die Freudsche Psychoanalyse beispielsweise, die keine spezifischen experimentellen Vorhersagen macht, ist in der Lage, ihre Theorie so zu überarbeiten, dass sie mit den Beobachtungen übereinstimmt, um zu vermeiden, dass die Theorie gänzlich verworfen wird. In diesem Sinne ist der Freudianismus eine Pseudowissenschaft – eine Theorie, die vorgibt, wissenschaftlich zu sein, aber in Wirklichkeit nicht falsifizierbar ist. Im Gegensatz dazu machte beispielsweise Einsteins Relativitätstheorie Vorhersagen (wie die Krümmung des Sternenlichts um die Sonne), die neu und spezifisch waren, und bot Möglichkeiten, die Theorie durch direkte experimentelle Beobachtung zu widerlegen. Befürworter von Poppers Definition scheinen jede Aussage – in der Metaphysik, der Ethik, der Theologie, der Literaturkritik und sogar im täglichen Leben -, die das Kriterium der Falsifizierbarkeit nicht erfüllt, auf die gleiche Ebene wie Pseudowissenschaft oder Nichtwissenschaft zu stellen.
Das Kriterium der Falsifizierbarkeit ist insofern reizvoll, als es Ähnlichkeiten zwischen der Wissenschaft und den Versuch-und-Irrtum-Methoden aufzeigt, die wir bei der Lösung alltäglicher Probleme anwenden. Wenn ich meine Schlüssel verlegt habe, beginne ich sofort, Szenarien – Hypothesen, wenn man so will – zu konstruieren, die den Verbleib der Schlüssel erklären könnten: Habe ich sie in der Zündung oder im Schloss der Haustür vergessen? Befanden sie sich in der Tasche der Jeans, die ich in den Wäschekorb gelegt habe? Habe ich sie beim Mähen des Rasens fallen lassen? Anschließend bewerte ich diese Szenarien systematisch, indem ich die Vorhersagen prüfe, von denen ich erwarte, dass sie bei jedem Szenario zutreffen – mit anderen Worten, ich wende eine Art Poppersche Methode an. Das alltägliche, vernünftige Kriterium der Falsifizierbarkeit hat den Vorteil, dass es einerseits zeigt, wie die Wissenschaft auf den grundlegenden Ideen der Rationalität und der Beobachtung beruht, und andererseits der Wissenschaft den Nimbus des heiligen Mysteriums nimmt, mit dem manche sie zu umgeben versuchen.
Eine weitere Stärke des Kriteriums der Falsifizierbarkeit ist, dass es eine klare Unterscheidung zwischen Wissenschaft im eigentlichen Sinne und den Meinungen von Wissenschaftlern zu nicht-wissenschaftlichen Themen ermöglicht. Wir haben in den letzten Jahren eine zunehmende Tendenz beobachtet, alles, was Wissenschaftler sagen oder glauben, als „wissenschaftlich“ zu betrachten. Die Debatten über die Stammzellenforschung zum Beispiel wurden sowohl in der wissenschaftlichen Gemeinschaft als auch in den Massenmedien oft als Auseinandersetzungen zwischen Wissenschaft und Religion beschrieben. Es stimmt, dass viele, aber bei weitem nicht alle der lautstärksten Befürworter der embryonalen Stammzellenforschung Wissenschaftler waren und dass viele, aber bei weitem nicht alle der lautstärksten Gegner der Forschung religiös waren. Tatsächlich wurde aber kaum über Wissenschaft gestritten: Im Mittelpunkt der Kontroverse standen zwei gegensätzliche Ansichten über ein bestimmtes ethisches Dilemma, von denen keine von Natur aus wissenschaftlicher war als die andere. Wenn wir unsere Definition von Wissenschaftlichkeit auf das Falsifizierbare beschränken, können wir natürlich nicht zu dem Schluss kommen, dass eine bestimmte ethische Ansicht von der Wissenschaft diktiert wird, nur weil sie die Ansicht einer beträchtlichen Anzahl von Wissenschaftlern ist. Die gleiche Logik gilt für die Urteile von Wissenschaftlern zu politischen, ästhetischen oder anderen nicht-wissenschaftlichen Fragen. Wenn eine Umfrage zeigt, dass eine große Mehrheit der Wissenschaftler beispielsweise neutrale Farben in Badezimmern bevorzugt, folgt daraus nicht, dass diese Präferenz „wissenschaftlich“ ist.
Poppers Falsifizierbarkeitskriterium und ähnliche essentialistische Definitionen der Wissenschaft unterstreichen die unterschiedliche, aber wichtige Rolle von Wissenschaft und Philosophie. Die Definitionen zeigen die notwendige Rolle der Philosophie bei der Untermauerung und Rechtfertigung der Wissenschaft – sie schützt sie vor ihrem Potenzial für Exzesse und Selbstschädigung, indem sie unter anderem klare Unterscheidungen zwischen legitimen wissenschaftlichen Theorien und pseudowissenschaftlichen Theorien vorschlägt, die sich als Wissenschaft ausgeben.
Im Gegensatz zu Popper haben viele Denker ein Verständnis von Philosophie und Wissenschaft entwickelt, das solche Unterscheidungen verwischt und zu einer überhöhten Rolle der Wissenschaft und einer untergeordneten Rolle der Philosophie führt. Zum Teil sind die Philosophen selbst schuld am Niedergang ihrer Disziplin – vor allem dank der logisch-positivistischen und analytischen Strömung, die seit etwa einem Jahrhundert in der englischsprachigen Welt vorherrscht. So sprach der einflussreiche amerikanische Philosoph W. V. O. Quine im 20. Jahrhundert bescheiden von einer „Philosophie in Kontinuität mit der Wissenschaft“ und gelobte, die traditionelle Beschäftigung der Philosophie mit metaphysischen Fragen, die den Anspruch erheben könnten, über die Naturwissenschaften zu urteilen, zu vermeiden. Die Wissenschaft, so schienen Quine und viele seiner Zeitgenossen zu sagen, ist der Ort des Geschehens, und die Philosophen sollten die Wissenschaft vom Rande aus feiern.
Diese Haltung wurde in der anderen Hauptgruppe der Wissenschaftstheorien zum Ausdruck gebracht, die mit den essentialistischen Auffassungen konkurriert – nämlich in den „institutionellen“ Theorien, die die Wissenschaft mit der sozialen Institution der Wissenschaft und ihren Praktikern identifizieren. Der institutionelle Ansatz kann für Wissenschaftshistoriker nützlich sein, da er es ihnen erlaubt, die verschiedenen Definitionen von Feldern zu akzeptieren, die von den Wissenschaftlern, die sie untersuchen, verwendet werden. Einige Philosophen gehen jedoch so weit, „institutionelle Faktoren“ als Kriterien für gute Wissenschaft zu verwenden. Ladyman, Ross und Spurrett sagen zum Beispiel, dass sie „gute Wissenschaft – mit unvermeidlich unscharfen Grenzen – durch institutionelle Faktoren und nicht durch direkte erkenntnistheoretische Faktoren abgrenzen“. Nach diesem Kriterium würden wir gute Wissenschaft von schlechter Wissenschaft unterscheiden, indem wir einfach fragen, welche Anträge von Agenturen wie der „National Science Foundation“ als förderungswürdig erachtet werden oder welche Arbeiten von Peer-Review-Ausschüssen als veröffentlichungswürdig eingestuft werden.
Die Probleme mit dieser Definition von Wissenschaft sind vielfältig. Erstens ist sie im Wesentlichen zirkulär: Wissenschaft ist einfach das, was Wissenschaftler tun. Zweitens sollte das große Vertrauen in Finanzierungs- und Peer-Review-Gremien jedem unangebracht erscheinen, der in diesen Gremien tätig war und miterlebt hat, wie sehr vorgefasste Meinungen, persönliche Rachegelüste und Ähnliches selbst die besten Vorschläge torpedieren können. Darüber hinaus wird die vereinfachende Definition von Wissenschaft durch ihre Institutionen durch die lange Geschichte wissenschaftlicher Institutionen erschwert, die sich als notorisch unzuverlässig erwiesen haben. Man denke nur an die Jahrzehnte, in denen die sowjetische Biologie von den ideologisch motivierten Theorien des Genetikers Trofim Lysenko beherrscht wurde, der die Mendelsche Genetik als unvereinbar mit dem Marxismus ablehnte und darauf bestand, dass erworbene Eigenschaften vererbt werden können. Einem Beobachter, der gute Wissenschaft von schlechter Wissenschaft „allein anhand institutioneller Faktoren“ unterscheidet, würde es schwer fallen, den Unterschied zwischen der unproduktiven und korrupten Genetik in der Sowjetunion und der fruchtbaren Forschung von Watson und Crick im Cambridge der 1950er Jahre zu erkennen. Können wir sicher sein, dass es nicht Teildisziplinen der Wissenschaft gibt, in denen die meisten Wissenschaftler auch heute noch Theorien unhinterfragt akzeptieren, die sich in der Zukunft als so absurd erweisen werden wie der Lysenkoismus? Vielen berufstätigen Wissenschaftlern fällt sicherlich mindestens ein Kandidat ein – nämlich eine in ihrem Fachgebiet weithin akzeptierte Theorie, die mit ziemlicher Sicherheit falsch, ja sogar absurd ist.
Angesichts solcher Beispiele verweisen die Verfechter des institutionellen Ansatzes häufig auf die angeblich selbstkorrigierende Natur der Wissenschaft. Ladyman, Ross und Spurrett behaupten, dass „der wissenschaftliche Fortschritt zwar bei weitem nicht gleichmäßig und linear verläuft, aber auch nicht einfach schwankt oder rückwärts geht. Jede wissenschaftliche Entwicklung beeinflusst die künftige Wissenschaft, und sie wiederholt sich nie“. Leider habe ich in den rund dreißig Jahren, in denen ich die Wissenschaft beobachte, festgestellt, dass einige wissenschaftliche Teilgebiete (wie die Verhaltensökologie) fröhlich vor sich hin oszillieren und alles darauf hindeutet, dass dies auch in absehbarer Zukunft der Fall sein wird. In der Geschichte der Wissenschaft gibt es viele Beispiele dafür, dass fehlerhafte Theorien schließlich verworfen werden. Wir sollten jedoch nicht allzu zuversichtlich sein, dass eine solche Selbstkorrektur unweigerlich eintreten wird, und auch nicht, dass die institutionellen Mechanismen der Wissenschaft so robust sind, dass lange dunkle Zeitalter, in denen falsche Theorien herrschen, ausgeschlossen werden können.
Das grundlegende Problem, das durch die Identifizierung von „guter Wissenschaft“ mit „institutioneller Wissenschaft“ aufgeworfen wird, besteht darin, dass man davon ausgeht, dass die Praktiker der Wissenschaft von Natur aus, zumindest auf lange Sicht, von den korrumpierenden Einflüssen ausgenommen sind, die alle anderen menschlichen Praktiken und Institutionen beeinflussen. Ladyman, Ross und Spurrett stellen ausdrücklich fest, dass die meisten menschlichen Institutionen, darunter „Regierungen, politische Parteien, Kirchen, Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen, ethnische Vereinigungen, Familien … epistemisch kaum zuverlässig sind. Unsere Grundannahme ist jedoch, dass die spezifischen institutionellen Prozesse der Wissenschaft induktiv eine besondere epistemische Zuverlässigkeit geschaffen haben“. Diese Annahme ist im besten Fall naiv und im schlimmsten Fall gefährlich. Wenn man davon ausgeht, dass irgendeine menschliche Institution von den kleinlichen, eigennützigen und korrumpierenden Motivationen, die uns alle plagen, ausgenommen ist, wird das Ergebnis fast zwangsläufig die Schaffung einer priesterlichen Kaste sein, die Bewunderung fordert und sich nur vor sich selbst verantworten muss.
Es ist diese Verehrung, die dem Rückzug der Philosophen und dem Aufstieg der Wissenschaftler als Autoritäten unserer Zeit in allen intellektuellen Fragen zugrunde zu liegen scheint. Liest man die Werke von Quine, Rudolf Carnap und anderen Philosophen der positivistischen Tradition sowie ihrer jüngeren Nachfolger, so fällt einem die Aura der Heldenverehrung auf, die der Wissenschaft und den Wissenschaftlern zuteil wird. Trotz ihrer Idealisierung der Wissenschaft zeigen die Philosophen dieser Schule erstaunlich wenig Interesse an der Wissenschaft selbst – d.h. an den Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung und ihren möglichen philosophischen Implikationen. Als Biologe muss ich zugeben, dass ich Quines ständige Berufung auf „Nervenenden“ als Allzweckerklärung für menschliches Verhalten peinlich vereinfachend finde. Vor allem in Anbetracht von Quines intellektuellem Engagement für den Behaviorismus ist es überraschend und doch bezeichnend, dass er offensichtlich wenig Interesse an den tatsächlichen Mechanismen hatte, mit denen das Nervensystem funktioniert.
Ross, Ladyman und Spurrett mögen Recht haben, wenn sie davon ausgehen, dass die Wissenschaft eine „eigentümliche epistemische Zuverlässigkeit“ besitzt, die anderen Formen der Forschung fehlt. Aber sie sind den seltsamen Schritt gegangen, diese Zuverlässigkeit mit den Institutionen und Praktikern der Wissenschaft zu identifizieren und nicht mit einem bestimmten rationalen, empirischen oder methodologischen Kriterium, an das sich die Wissenschaftler halten müssen (was ihnen aber oft nicht gelingt). So hat die (größtenteils gerechtfertigte) Bewunderung für die Arbeit von Wissenschaftlern zu einer eigenartigen, ungerechtfertigten Rolle für die Wissenschaftler selbst geführt – so dass das, was von Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit als „wissenschaftlich“ angesehen wird, in zunehmendem Maße einfach jede Behauptung ist, die von vielen Wissenschaftlern vertreten wird oder die auf Sprache und Ideen beruht, die wissenschaftlichen Theorien hinreichend ähnlich klingen.
Die Finsternis der Metaphysik
Es gibt mindestens drei Forschungsbereiche, die traditionell in den Zuständigkeitsbereich der Philosophie fallen und von denen heute oft behauptet wird, dass sie am besten – oder ausschließlich – wissenschaftlich untersucht werden können: Metaphysik, Erkenntnistheorie und Ethik. Lassen Sie uns diese Bereiche nacheinander erörtern.
Die Physiker Stephen Hawking und Leonard Mlodinow beginnen ihr 2010 erschienenes Buch „The Grand Design“ mit der Frage:
Was ist das Wesen der Realität? Woher kommt das alles? Brauchte das Universum einen Schöpfer? … Traditionell sind das Fragen für die Philosophie, aber die Philosophie ist tot. Die Philosophie hat mit den modernen Entwicklungen der Wissenschaft, insbesondere der Physik, nicht Schritt gehalten. Die Wissenschaftler sind zu Trägern der Fackel der Entdeckung in unserem Streben nach Wissen geworden.
Obwohl Physiker die Metaphysik einst als reine Spekulation abgetan haben mögen, hätten sie solche Fragen auch als inhärent spekulativ und damit jenseits ihres eigenen Fachgebiets bezeichnet. Die Behauptungen von Hawking und Mlodinow und vielen anderen Autoren stellen daher eine auffällige Abweichung von der traditionellen Sichtweise dar.
Im Gegensatz zu den Behauptungen dieser Autoren, dass die Philosophie veraltet sei, gibt es eine merkwürdige Übereinstimmung zwischen den Erkenntnissen der modernen Kosmologie und einigen traditionellen Auffassungen von der Entstehung des Universums. Theisten haben zum Beispiel festgestellt, dass das als Urknall bekannte Modell eine gewisse Übereinstimmung mit der jüdisch-christlichen Vorstellung von der Schöpfung ex nihilo aufweist, eine Übereinstimmung, die in anderen Kosmologien, die ein ewig existierendes Universum postulieren, nicht zu finden ist. (Als der Astronom und Priester Georges Lemaître diese Theorie erstmals aufstellte, stieß er bei den Befürwortern eines ewigen Universums auf so viel Skepsis, dass seine Gegner den Namen „Urknall“ prägten – als Spottbegriff). Ebenso haben viele Kosmologen verschiedene Formen des so genannten „anthropischen Prinzips“ formuliert, d. h. die Beobachtung, dass die grundlegenden Gesetze des Universums so „fein abgestimmt“ zu sein scheinen, dass sie für das Leben, einschließlich des menschlichen Lebens, günstig sind.
Vielleicht ist es zum Teil eine Reaktion auf diese offensichtliche Übereinstimmung, dass in den letzten Jahrzehnten eine große Fach- und Populärliteratur entstanden ist, die sich mit Theorien über Multiversen, „viele Welten“ und „Landschaften“ der Realität befasst, die das Fehlen einer besonderen Begünstigung der Menschheit wiederherzustellen scheinen. Hawking und Mlodinow zum Beispiel erklären, dass
die Feinabstimmung der Naturgesetze durch die Existenz mehrerer Universen erklärt werden [kann]. Viele Menschen haben im Laufe der Jahrhunderte die Schönheit und Komplexität der Natur, für die es zu ihrer Zeit keine wissenschaftliche Erklärung zu geben schien, Gott zugeschrieben. Doch so wie Darwin und Wallace erklärten, wie der scheinbar wundersame Aufbau der Lebewesen ohne das Eingreifen eines höheren Wesens zustande kommen konnte, kann das Konzept des Multiversums die Feinabstimmung der physikalischen Gesetze erklären, ohne dass ein wohlwollender Schöpfer, der das Universum zu unserem Nutzen geschaffen hat, erforderlich ist.
Die Multiversumstheorie besagt, dass es viele verschiedene Universen gibt, von denen unseres nur eines ist, und dass jedes sein eigenes System physikalischer Gesetze hat. Das Argument, das Hawking und Mlodinow vorbringen, ist im Wesentlichen eines aus den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit: Wenn es genügend Universen gibt, ist die Entstehung eines oder mehrerer Universen, deren Gesetze für die Entwicklung von intelligentem Leben geeignet sind, mehr oder weniger vorprogrammiert.
Der Physiker Lee Smolin geht in seinem 1997 erschienenen Buch „The Life of the Cosmos“ noch einen Schritt weiter, indem er die Prinzipien der natürlichen Selektion auf ein Multiversenmodell anwendet. Smolin postuliert, dass aus schwarzen Löchern neue Universen entstehen und dass die physikalischen Gesetze eines Universums dessen Neigung zur Entstehung von schwarzen Löchern bestimmen. Die physikalischen Gesetze eines Universums dienen somit als sein „Genom“, und diese „Genome“ unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Neigung, einem Universum die „Fortpflanzung“ durch die Schaffung neuer Universen zu ermöglichen. So kommt es zum Beispiel vor, dass ein Universum mit viel Kohlenstoff sehr gut darin ist, schwarze Löcher zu erzeugen – und ein Universum mit viel Kohlenstoff ist auch eines, das die Evolution des Lebens begünstigt. Damit sein Evolutionsprozess funktioniert, geht Smolin auch von einer Art Mutationsmechanismus aus, bei dem die physikalischen Gesetze eines Universums in den Nachfolgeuniversen leicht verändert werden können. Für Smolin ist unser Universum also nicht nur zwangsläufig entstanden, weil die Würfel schon oft gefallen sind, sondern die Würfel sind auch zugunsten eines Universums wie dem unseren gefallen, weil es ein besonders „passendes“ Universum ist.
Diese Argumente können zwar die Schlussfolgerung entkräften, dass unser Universum auf uns abgestimmt ist, aber sie können die grundlegenden metaphysischen Fragen, die durch die Tatsache aufgeworfen werden, dass etwas – ob ein oder viele Universen – und nicht nichts existiert, nicht umgehen oder gar beantworten. Der Hauptfehler dieser Argumente liegt darin, dass sie nicht zwischen notwendigem und kontingentem Sein unterscheiden. Ein kontingentes Wesen ist ein Wesen, das existieren oder nicht existieren könnte und daher bestimmte Eigenschaften haben oder nicht haben könnte. Im Zusammenhang mit der modernen Quantenphysik oder der Populationsgenetik könnte man sogar Wahrscheinlichkeitswerte für die Existenz oder Nichtexistenz eines kontingenten Wesens angeben. Aber ein notwendiges Wesen ist eines, das existieren muss und dessen Eigenschaften nicht anders sein können als sie sind.
Die Multiversumstheoretiker sagen einfach, dass unser Universum und seine Gesetze lediglich ein kontingentes Wesen sind, und dass andere Universen denkbar sind und daher ebenfalls existieren können, wenn auch kontingent. Die Idee der kontingenten Natur unseres Universums mag dem modernen Materialismus zuwiderlaufen und daher vielen Physikern und Philosophen neu erscheinen, aber sie ist nicht wirklich neu. Thomas von Aquin beispielsweise begann den dritten seiner berühmten fünf Beweise für die Existenz Gottes (ein Wesen, das „aus sich selbst heraus notwendig“ ist) mit der Feststellung des kontingenten Seins („wir finden unter den Dingen gewisse, die sein könnten oder nicht sein könnten“). Unabhängig davon, ob man von Aquinas überzeugt ist oder nicht, sollte klar sein, dass die „Entdeckung“, dass unser Universum ein kontingentes Ereignis unter anderen kontingenten Ereignissen ist, vollkommen mit seiner Argumentation vereinbar ist.
Autoren wie Hawking, Mlodinow und Smolin nutzen jedoch die kontingente Natur unseres Universums und seiner Gesetze, um für eine ganz andere Schlussfolgerung als die von Aquin zu argumentieren – nämlich, dass irgendein kontingentes Universum (ob es sich nun als unseres herausstellte oder nicht) entstanden sein muss, ohne dass es ein notwendiges Wesen gibt. Auch hier ist die Wahrscheinlichkeit ein wesentlicher Bestandteil des Arguments: Während ein Universum mit einem bestimmten Satz von Gesetzen sehr unwahrscheinlich sein mag, wird es bei einer ausreichenden Anzahl von Universen sehr wahrscheinlich. Dies ist dasselbe Prinzip, das dahinter steckt, daß – wenn ich eine Münze werfe, obwohl es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass ich Kopf erhalte und eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich Zahl erhalte – es sicher ist, dass ich Kopf oder Zahl erhalte. In ähnlicher Weise unterstellen moderne Theoretiker, dass das Multiversum ein notwendiges Sein hat, auch wenn ein bestimmtes Universum dies nicht hat.
Das Problem bei diesem Argument ist, dass Gewissheit im Sinne von Wahrscheinlichkeit nicht dasselbe ist wie notwendiges Sein: Wenn ich eine Münze werfe, ist es sicher, dass ich Kopf oder Zahl erhalte, aber dieses Ergebnis hängt davon ab, dass ich die Münze werfe, was ich nicht unbedingt tue. In gleicher Weise kann ein bestimmtes Universum aus der Existenz eines Multiversums folgen, aber die Existenz des Multiversums bleibt zu erklären. Insbesondere ist der von einigen Multiversumstheorien angenommene Prozess der Universumsentstehung selbst kontingent, da er von der Wirkung der von der Theorie angenommenen Gesetze abhängt. Letztere könnte man als Meta-Gesetze bezeichnen, da sie die Grundlage für die Entstehung der einzelnen Universen bilden, von denen jedes seinen eigenen individuellen Satz von Gesetzen hat. Was also bestimmt die Meta-Gesetze? Entweder müssen wir Meta-Meta-Gesetze einführen und so weiter in unendlicher Regression, oder wir müssen davon ausgehen, dass die Meta-Gesetze selbst notwendig sind – und damit haben wir im Grunde nur unser Verständnis davon geändert, was das fundamentale Universum ist – und zwar zu einem, das viele Universen enthält. In diesem Fall haben wir immer noch keine endgültige Erklärung dafür, warum dieses Universum existiert oder die Eigenschaften hat, die es hat.
Wenn es um solche metaphysischen Fragen geht, können die Wissenschaft und die wissenschaftliche Spekulation viel zur Klärung von Details beitragen, aber sie haben es bisher versäumt, Erklärungen anzubieten, die für die Philosophie grundlegend neu sind – geschweige denn, dass sie sie völlig verdrängt hätten.
Die Finsternis der Erkenntnistheorie
Hawking und Mlodinow zitieren in dem Kapitel ihres Buches „The Theory of Everything“ Albert Einstein: „Das Unbegreiflichste am Universum ist, dass es begreifbar ist.“ Hawking und Mlodinow bieten im Gegenzug folgende krachende Banalität an: „Das Universum ist verständlich, weil es wissenschaftlichen Gesetzen unterliegt, d. h. sein Verhalten kann modelliert werden.“ Später laden die Autoren uns ein, uns selbst auf die Schulter zu klopfen: „Die Tatsache, dass wir Menschen – die wir selbst nur Ansammlungen von fundamentalen Teilchen der Natur sind – in der Lage waren, einem Verständnis der Gesetze, die uns und unser Universum regieren, so nahe zu kommen, ist ein großer Triumph.“ Großer Triumph hin oder her, das Einsteinsche Paradoxon wird dadurch nicht gelöst, denn es wird keine Erklärung dafür angeboten, warum unser Universum „von wissenschaftlichen Gesetzen beherrscht“ wird.
Und selbst wenn wir sicher sein können, dass unser Universum unveränderlichen physikalischen Gesetzen unterliegt – was viele der neuen spekulativen Kosmologien in Frage stellen -, wie können wir, „bloße Ansammlungen von Teilchen“, diese Gesetze erkennen? Wie können wir darauf vertrauen, dass wir sie immer besser erkennen werden, bis wir sie vollständig verstanden haben? Eine gängige Antwort auf diese Fragen ist die Berufung auf das, was zum allumfassenden Erklärungsinstrument der Verfechter des Szientismus geworden ist: die Evolution. W. V. O. Quine war einer der ersten modernen Philosophen, der evolutionäre Konzepte auf die Erkenntnistheorie anwandte, als er in „Ontological Relativity and Other Essays“ (1969) argumentierte, dass die natürliche Auslese die Entwicklung von Merkmalen im Menschen begünstigt hätte, die uns dazu bringen, Wahrheit von Unwahrheit zu unterscheiden, mit der Begründung, dass der Glaube an Falsches der Angepaßtheit abträglich ist. In jüngerer Zeit werden auch wissenschaftliche Theorien selbst als Objekte der natürlichen Auslese betrachtet. So argumentierte der Philosoph Bastiaan C. van Fraassen in seinem 1980 erschienenen Buch „The Scientific Image“:
Der Erfolg der aktuellen wissenschaftlichen Theorien ist kein Wunder. Er ist nicht einmal für den wissenschaftlichen (darwinistischen) Verstand überraschend. Denn jede wissenschaftliche Theorie wird in einen erbitterten Wettbewerb hineingeboren, in einen Dschungel, der vor Zähnen und Klauen rot gefärbt ist. Nur die erfolgreichen Theorien überleben – diejenigen, die sich an tatsächliche Regelmäßigkeiten in der Natur anlehnen.
Richard Dawkins hat diese Analyse bekanntlich auf Ideen im Allgemeinen ausgedehnt, die er „Meme“ nennt.
Die Vorstellung, dass unser Verstand und unsere Sinne darauf ausgerichtet sind, Wissen zu finden, hat einen gewissen intuitiven Reiz; wie Aristoteles lange vor Darwin feststellte, „wollen alle Menschen von Natur aus wissen“. Aus evolutionärer Sicht ist es jedoch keineswegs offensichtlich, dass es immer einen Vorteil für die „Fitness“ [im Darwin’schen Sinne, Anm. d. Übersetzers, also im Sinne der „Angepaßtheit“] bedeutet, die Wahrheit zu kennen. Man könnte zugeben, dass es für meine „Fitness“ sehr vorteilhaft sein kann, bestimmte Fakten in bestimmten Zusammenhängen zu kennen: Wenn mich zum Beispiel ein Säbelzahntiger angreifen will, ist es wahrscheinlich von Vorteil, wenn ich diese Tatsache kenne. Eine genaue Wahrnehmung ist im Allgemeinen wahrscheinlich von Vorteil. Und einfache Mathematik, wie das Zählen, könnte in vielen Zusammenhängen von Vorteil für die „Fitness“ sein – zum Beispiel, um den Überblick über meine zahlreichen Nachkommen zu behalten, wenn Säbelzahntiger in der Nähe sind. Möglicherweise war sogar die menschliche Neigung, genealogische Informationen zu sammeln und damit ein intuitives Gefühl für den Grad der Verwandtschaft zwischen den Mitgliedern einer sozialen Gruppe zu entwickeln, vorteilhaft, weil sie die Neigung eines Organismus erhöhte, Artgenossen mit einem ähnlichen Genotyp wie den eigenen zu schützen. Das allgemeine erkenntnistheoretische Argument dieser Autoren geht jedoch weit über solche elementaren Bedürfnisse hinaus. Während es plausibel sein mag, sich einen Fitnessvorteil für einfache Klassifizierungs- und Zählfähigkeiten vorzustellen, ist es sehr schwer, einen solchen Vorteil für die DNA-Sequenzanalyse oder die Quantentheorie zu sehen.
Ähnliches gilt, wenn man die Ideen selbst oder die Eigenschaften, die es uns ermöglichen, Ideen zu bilden, als Objekte der natürlichen Selektion betrachtet. In beiden Fällen hängt die „Fitness“ einer Idee von ihrer Fähigkeit ab, breite Zustimmung und Akzeptanz zu finden. Es gibt jedoch wenig Grund zu der Annahme, dass die natürliche Auslese die Fähigkeit oder den Wunsch begünstigt hat, die Wahrheit in allen Fällen zu erkennen, und nicht nur eine nützliche Annäherung an die Wahrheit. In manchen Kontexten kann ein gewisses Maß an Selbsttäuschung unter dem Gesichtspunkt der Fitness sogar von Vorteil sein. Es gibt eine umfangreiche soziobiologische Literatur über die möglichen Fitnessvorteile der Selbsttäuschung beim Menschen (der Evolutionsbiologe Robert L. Trivers hat diese in einem Artikel aus dem Jahr 2000 in den „Annals of the New York Academy of Sciences“ zusammengefasst).
Diese Beschwörungen der Evolution werfen auch ein Schlaglicht auf einen anderen häufigen Missbrauch evolutionärer Ideen: nämlich die Vorstellung, dass sich ein bestimmtes Merkmal entwickelt haben muss, nur weil wir uns ein Szenario vorstellen können, in dem der Besitz dieses Merkmals für die „Fitness“ von Vorteil gewesen wäre. Leider haben sich sowohl Biologen als auch Philosophen allzu oft dieser Art von unzulässigen Schlussfolgerungen schuldig gemacht. Solche Versuche, evolutionäre Erklärungen zu finden, laufen letztlich eher auf Geschichten als auf Hypothesenprüfung im wissenschaftlichen Sinne hinaus. Für eine vollständige evolutionäre Erklärung eines Phänomens reicht es nicht aus, eine Geschichte darüber zu konstruieren, wie sich das Merkmal als Reaktion auf einen bestimmten Selektionsdruck entwickelt haben könnte; vielmehr muss man eine Art Beweis dafür liefern, dass es sich tatsächlich so entwickelt hat. Das ist ein sehr hoher Anspruch, vor allem, wenn es sich um menschliche Geistes- oder Verhaltensmerkmale handelt, deren genetische Grundlagen wir noch lange nicht verstehen.
Evolutionsbiologen sind heute weniger geneigt, als Darwin es war, zu erwarten, dass jedes Merkmal eines jeden Organismus durch positive Selektion erklärbar sein muss. Tatsächlich gibt es zahlreiche Belege dafür – wie in Büchern wie Motoo Kimuras „The Neutral Theory of Molecular Evolution“ (1983), Stephen Jay Goulds „The Structure of Evolutionary Theory“ (2002) und Michael Lynchs „The Origins of Genome Architecture“ (2007) beschrieben -, dass viele Merkmale von Organismen durch Mutationen entstanden sind, die durch Zufall festgelegt wurden und weder selektiv begünstigt noch benachteiligt wurden. Die Tatsache, dass jede Spezies, einschließlich der unseren, Merkmale aufweist, die keinen offensichtlichen Nutzen für die „Fitness“ bringen, steht in völligem Einklang mit dem, was wir über die Evolution wissen. Die natürliche Auslese kann vieles darüber erklären, warum Arten so sind, wie sie sind, aber sie bietet nicht unbedingt eine spezifische Erklärung für die intellektuellen Fähigkeiten des Menschen, geschweige denn irgendeine Grundlage für das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Wissenschaft.
Was van Fraassen, Quine und diese anderen Denker ansprechen, ist eine Art popularisierter und falsch angewandter Darwinismus, der wenig mit der tatsächlichen Funktionsweise der Evolution zu tun hat, der aber in populären Schriften aller Art auftaucht – und sogar, wie ich bei meiner eigenen Arbeit als Evolutionsbiologe festgestellt habe, in der von Experten begutachteten Literatur. Von einem „darwinistischen“ Selektionsprozess unter den kulturell überlieferten Ideen zu sprechen, egal ob es sich um wissenschaftliche Theorien oder Meme handelt, ist bestenfalls eine lose Analogie mit höchst irreführenden Implikationen. Sie wird leicht zu einem interpretatorischen Blankoscheck, der Spekulationen zulässt, die jede beschreibbare menschliche Eigenschaft zu erklären scheinen. Darüber hinaus helfen diese Argumente selbst bei der stärksten Auslegung bestenfalls ein wenig bei der Erklärung, warum wir Menschen in der Lage sind, das Universum zu verstehen – aber sie sagen immer noch nichts darüber aus, warum das Universum selbst verständlich ist.
Die Finsternis der Ethik
Auf keinem Gebiet der Philosophie haben sich die Befürworter des Szientismus mehr Mühe gegeben als auf dem der Ethik. Viele von ihnen neigen zu einer Position des moralischen Relativismus. Dieser Position zufolge befasst sich die Wissenschaft mit dem Objektiven und Faktischen, während ethische Aussagen lediglich das subjektive Empfinden der Menschen wiedergeben; es kann kein universelles Richtig oder Falsch geben. Es überrascht nicht, dass es Philosophen gibt, die diese Meinung kodifiziert haben. In der positivistischen Tradition wurde viel von einer „Fakten-Wert-Unterscheidung“ gesprochen, die besagt, dass sich die Wissenschaft mit Fakten befasst, während sich Bereiche wie die Ethik (und die Ästhetik) mit der nebulösen und völlig disparaten Welt der Werte befassen. In seinem einflussreichen Buch „Ethics: Inventing Right and Wrong“ (1977) ging der Philosoph J. L. Mackie sogar noch weiter und argumentierte, dass die Ethik im Grunde auf einer falschen Theorie über die Realität beruht.
Die Evolutionsbiologie wurde seit dem neunzehnten Jahrhundert oft als äußerst relevant für die Ethik angesehen. Der Sozialdarwinismus – zumindest so, wie er von späteren Generationen erklärt und verstanden wurde – war eine Ideologie, die den Laissez-faire-Kapitalismus mit dem Hinweis auf den natürlichen „Kampf ums Dasein“ rechtfertigte. In den Schriften von Autoren wie Herbert Spencer wurde die Anhäufung von Reichtum ohne Rücksicht auf die weniger Glücklichen als „der Weg der Natur“ gerechtfertigt. Natürlich ist der „Kampf“ bei der natürlichen Auslese kein Kampf um die Anhäufung eines Aktienportfolios, sondern ein Kampf um die Fortpflanzung – und ironischerweise entstand der Sozialdarwinismus genau zu dem Zeitpunkt, als die wohlhabenden Klassen der westlichen Nationen begannen, ihre Fortpflanzung einzuschränken (der so genannte „demografische Übergang“), was dazu führte, dass der wirtschaftliche Kampf und der darwinistische Kampf einander entgegengesetzt waren.
Zum Teil als Reaktion auf diesen Widerspruch entstand die Eugenik-Bewegung mit ihrem Schlachtruf: „Die Untauglichen vermehren sich wie die Karnickel; wir müssen etwas tun, um sie zu stoppen!“ Obwohl viele prominente Darwinisten zu ihrer Zeit solche Ansichten vertraten, kann man sich vom darwinistischen Standpunkt aus kein zusammenhangloseres Plädoyer vorstellen: Wenn die große Masse an „Ungewaschenen“ die vornehmen Klassen ausstechen, kann das nur bedeuten, dass die großen Ungewaschenen die Stärksten sind, nicht die vermeintlichen „Gewinner“ des wirtschaftlichen Kampfes. Es sind die vornehmeren Klassen mit ihrer zurückhaltenden Reproduktion, die die Untauglichen sind. Die Grundlagen der Eugenik sind also vom darwinistischen Standpunkt aus gesehen völliger Unsinn.
Der unappetitliche Charakter des Sozialdarwinismus und damit verbundener Ideen wie der Eugenik führte zu einer deutlichen Verfinsterung der Evolutionsethik. Doch seit den 1970er Jahren, mit dem Aufkommen der Soziobiologie und ihrer neueren Ableger, der Evolutionspsychologie, ist das Interesse an der Evolutionsethik bei Philosophen, Biologen, Psychologen und populären Schriftstellern wieder stark gestiegen.
Es sollte betont werden, dass es so etwas wie eine wirklich wissenschaftliche menschliche Soziobiologie oder Evolutionspsychologie gibt. In diesem Bereich werden falsifizierbare Hypothesen aufgestellt und mit realen Daten über menschliches Verhalten getestet. Die grundlegenden Methoden ähneln denen der Verhaltensökologie, die mit einigem Erfolg auf das Verständnis der Verhaltensanpassungen nicht-menschlicher Tiere angewandt wurden und die ein ähnliches Licht auf Aspekte des menschlichen Verhaltens werfen können – obwohl diese Bemühungen durch die kulturelle Variabilität des Menschen erschwert werden. Andererseits gibt es auch eine umfangreiche Literatur, die sich einer Art Pop-Soziobiologie widmet, die sich mit ungeprüften – und oft unprüfbaren – Spekulationen befasst, und es sind die Pop-Soziobiologen, die am ehesten die ethische Relevanz ihrer angeblichen Entdeckungen betonen.
Als die Evolutionspsychologie aufkam, lehnten ihre Vertreter den Sozialdarwinismus und die Eugenik im Allgemeinen schnell ab und bezeichneten sie als „Missbrauch“ der evolutionären Ideen. Es stimmt, dass beide auf inkohärenten Überlegungen beruhen, die mit den grundlegenden Konzepten der biologischen Evolution unvereinbar sind; aber es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass einige sehr wichtige Persönlichkeiten in der Geschichte der Evolutionsbiologie diese Ungereimtheiten nicht gesehen haben, da sie, wie es scheint, durch ihre sozialen und ideologischen Vorurteile geblendet waren. Die Geschichte dieser Ideen ist ein weiteres abschreckendes Beispiel für die Fehlbarkeit der institutionellen Wissenschaft, wenn es darum geht, selbst ihre eigenen Theorien richtig zu stellen.
Dennoch wurde uns gesagt, dass die Evolutionspsychologie etwas ganz anderes sei als der Sozialdarwinismus. Sie vermied das Politische und konzentrierte sich auf das Persönliche. Ein Bereich des menschlichen Lebens, dem die Psychologie viel Aufmerksamkeit gewidmet hat, ist der Sex, wobei sie sich Geschichten ausdenkt, um die „adaptive“ Natur jeder Art von Verhalten zu erklären, von der Untreue bis zur Vergewaltigung. Wie bei den erkenntnistheoretischen Erklärungen wird auch hier oft der Schluss gezogen, dass die natürliche Auslese dieses oder jenes Verhalten begünstigt haben muss, weil sie es „sollte“. Die stillschweigende Annahme scheint zu sein, dass das bloße Aufzählen dieser Geschichten sie irgendwie zu Tatsachen macht. (Oft scheint es sogar eine Art von Vergnügen zu geben, mit dem diese Geschichten ausgearbeitet werden – je öfter, desto durch und durch verdorbener das Verhalten.) Der typische nächste Schritt besteht darin, genau die Verhaltensweisen zu beklagen, die der Evolutionspsychologe gerade als Teil unseres evolutionären Erbes und vielleicht unseres Instinkts bezeichnet hat: Natürlich billigen wir solche Dinge heute nicht, damit niemand auf falsche Gedanken kommt. Dieses Bedauern wird oft von einer frommen Beschwörung der Unterscheidung zwischen Fakten und Werten begleitet (obwohl in der Regel überhaupt keine Fakten aufgetaucht sind – nur Spekulationen).
Es scheint einen großen Bedarf an dieser Art von Erklärung zu geben, aber die populären Evolutionspsychologen schenken den philosophischen Fragen, die ihre evolutionären Szenarien aufwerfen, im Allgemeinen wenig Aufmerksamkeit. Wenn „wir jetzt wissen“, dass das egoistische Verhalten unserer Vorfahren moralisch verwerflich ist, wie sind „wir“ dann zu dieser Erkenntnis gekommen? Auf welcher Grundlage können wir sagen, dass überhaupt irgendetwas falsch ist, wenn unser Verhalten nur die Folge einer vergangenen natürlichen Selektion ist? Und wenn wir uns wünschen, moralisch besser zu sein als unsere Vorfahren, sind wir dann überhaupt frei, dies zu tun? Oder sind wir auf ein bestimmtes Verhalten programmiert, das wir nun aus irgendeinem Grund zu beklagen haben?
Andererseits gibt es eine ernsthaftere philosophische Literatur, die versucht, sich mit einigen der Fragen zu den Grundlagen der Ethik auseinanderzusetzen, die sich aus den Überlegungen zur Evolutionsbiologie des Menschen ergeben – zum Beispiel Richard Joyces Buch „The Evolution of Morality“ von 2006. Leider besteht ein Großteil dieser Literatur aus noch mehr Märchenerzählungen – Szenarien, in denen die natürliche Auslese ein allgemeines moralisches Empfinden oder die Neigung, bestimmte Verhaltensweisen wie Kooperation zu billigen, begünstigt haben könnte. Solche Szenarien sind an sich nicht unplausibel, aber sie bleiben im Bereich der reinen Spekulation und es ist im Grunde genommen unmöglich, sie auf eine strenge Art und Weise zu testen. Dennoch haben diese Ideen großen Einfluss gewonnen.
Ein Teil dieses evolutionären Ansatzes in der Ethik zielt auf eine Entlarvung der Moral ab. Da unsere Moralvorstellungen das Ergebnis einer natürlichen Auslese von Eigenschaften sind, die für unsere Vorfahren nützlich waren, so argumentieren die Entlarver, können sich diese Moralvorstellungen nicht auf objektive ethische Wahrheiten beziehen. Aber nur weil bestimmte Moralvorstellungen für unsere Vorfahren nützlich waren, sind sie nicht unbedingt falsch. Es wäre schwierig, beispielsweise die Genauigkeit unserer visuellen Wahrnehmung aufgrund ihrer Nützlichkeit für unsere Vorfahren oder die Wahrheit der Arithmetik aufgrund derselben zu widerlegen.
Wahre ethische Aussagen – wenn es sie denn gibt – sind von einer ganz anderen Art als wahre Aussagen der Arithmetik oder der Beobachtungswissenschaft. Man könnte argumentieren, dass unsere Vorfahren die Fähigkeit entwickelt haben, die menschliche Natur zu verstehen, und dass sie daher wahre ethische Aussagen aus dem Verständnis dieser Natur ableiten konnten. Dies ist jedoch kaum eine neue Entdeckung der modernen Wissenschaft: Bereits Aristoteles hat in der Nikomachischen Ethik auf diesen Punkt hingewiesen. Wenn der Mensch das Produkt der Evolution ist, dann ist es in gewisser Weise wahr, dass alles, was wir tun, das Ergebnis eines evolutionären Prozesses ist – aber es ist schwer zu erkennen, was zu Aristoteles‘ Verständnis hinzukommt, wenn wir sagen, dass wir in der Lage sind, als Ergebnis eines evolutionären Prozesses so zu denken wie er. (Ein analoges Argument ließe sich über die kantische Ethik anführen.)
Nicht alle Befürworter des Szientismus fallen auf die Probleme herein, die mit der Reduzierung der Ethik auf die Evolution verbunden sind. Sam Harris ist in seinem 2010 erschienenen Buch „The Moral Landscape“ ein Verfechter des Szientismus, der das gesamte Projekt der Evolutionsethik in Frage stellt. Dennoch möchte er einen Ableger des Szientismus ersetzen, der vielleicht sogar noch problematischer und mit Sicherheit bewährter ist: den Utilitarismus. In Harris‘ ethischem Rahmen ist das zentrale Kriterium für die Beurteilung, ob ein Verhalten moralisch ist, ob es zum „Wohlbefinden bewusster Geschöpfe“ beiträgt oder nicht. Harris‘ Ideen weisen all die Probleme auf, die die utilitaristische Philosophie von Anfang an geplagt haben. Wie die Utilitaristen seit geraumer Zeit behauptet Harris, die Unterscheidung zwischen Fakten und Werten in Frage zu stellen, oder besser gesagt, die heikle Frage der Werte ganz zu umgehen, indem er sich nur auf Fakten konzentriert. Aber wie es auch bei den Utilitaristen seit einiger Zeit der Fall ist, endet dieser Schritt damit, dass man bestimmte Werte gegenüber anderen bevorzugt, ohne für sie zu argumentieren, und dass man große Fragen zu diesen Werten ungelöst lässt.
Harris geht zum Beispiel nicht auf die zeitliche Bindung solcher Bewertungen ein: Berücksichtigen wir nur das Wohlergehen von Lebewesen, die genau zum Zeitpunkt unserer Analyse bei Bewusstsein sind? Wenn ja, warum sollten wir eine solche Voreingenommenheit akzeptieren? Was ist mit Lebewesen, die in naher Zukunft ein Bewusstsein besitzen werden – oder ohne menschliches Eingreifen besitzen würden – wie menschliche Embryonen, deren Vernichtung Harris für die Zwecke der Stammzellenforschung vehement befürwortet? Was ist mit komatösen Patienten, deren Bewusstsein und die Aussichten auf ein zukünftiges Bewusstsein ungewiss sind? Harris könnte entgegnen, dass es ihm nur um das Wohlergehen von Lebewesen geht, die jetzt ein Bewusstsein haben, und nicht um irgendwelche potenziell zukünftigen bewussten Lebewesen. Aber wenn das so ist, sollte er dann nicht zum Beispiel dafür plädieren, alle nicht erneuerbaren Ressourcen der Erde in einer großen Explosion hier und jetzt zu verbrauchen, um das physische Wohlergehen der jetzt Lebenden zu verbessern, und künftige Generationen verdammt sein lassen? Dennoch behauptet Harris, ein Naturschützer zu sein. Die beste Rechtfertigung für die Ressourcenerhaltung auf der Grundlage seiner Ethik wäre sicherlich, dass sie das Wohlergehen künftiger Generationen bewusster Lebewesen fördert. Wenn diese potenziellen zukünftigen Lebewesen unsere Rücksichtnahme verdienen, warum sollten wir dann nicht die gleiche Rücksicht auf die bereits existierenden Lebewesen nehmen, deren potenzielle Zukunft Bewusstsein beinhaltet?
Außerdem kann die von Harris angepriesene faktische Analyse nicht annähernd das Gewicht der von ihm behaupteten ethischen Untersuchung tragen. Harris argumentiert, dass die Frage, welche Faktoren zum „Wohlbefinden bewusster Lebewesen“ beitragen, eine faktische Frage ist, und dass die Wissenschaft Einblicke in diese Faktoren geben und eines Tages vielleicht sogar endgültige Aussagen darüber machen kann. Harris selbst hat sich an Forschungen beteiligt, die den Zustand des Gehirns menschlicher Versuchspersonen bei einer Reihe von Aufgaben untersucht haben. Obwohl die bildgebenden Verfahren des Gehirns immer wieder überbewertet werden, werden die Grenzen dieser Art von Forschung immer deutlicher. Selbst für sich genommen liefern diese Studien bestenfalls Beweise für Korrelation, nicht für Kausalität, sowie für Korrelationen, die mit dem unergründlich komplexen Zusammenspiel von Ursache und Wirkung, das Gehirn und Geist ausmachen, vermischt sind. Diese Studien erheben den Anspruch, die Probleme des Verständnisses des subjektiven Bewusstseins durch die Untersuchung des Gehirns zu umgehen, aber die grundsätzliche Ungleichheit zwischen der qualitativen Erfahrung aus der ersten Person heraus und den Ereignissen der dritten Person, die von jedem untersucht werden können, setzt den üblichen reduktiven Techniken der empirischen Wissenschaft grundlegende Grenzen.
Wir könnten Harris‘ Annahme zustimmen, dass die Neurowissenschaften eines Tages in großen biochemischen und physiologischen Details eine Reihe von Faktoren aufzeigen werden, die in hohem Maße mit dem Wohlbefinden in Verbindung stehen. Selbst dann wären dem menschlichen Glücksempfinden durch dieses Wissen Grenzen gesetzt. Zum Vergleich: Wir wissen eine ganze Menge über die Physiologie der Verdauung und sind in der Lage, die physiologischen Unterschiede zwischen dem Verdauungssystem eines Menschen, der hungert, und dem eines Menschen, der gerade eine sättigende und ernährungsphysiologisch ausgewogene Mahlzeit gegessen hat, genau zu beschreiben. Aber dieses Wissen trägt wenig zur Lösung des Welthungers bei. Denn der Faktor, der den Unterschied ausmacht – nämlich die Mahlzeit -, kommt von außen auf den Menschen zu. Solange die Faktoren, die für unser Wohlbefinden verantwortlich sind, nicht in erster Linie von innen kommen und völlig unabhängig davon sind, was in unserer Umgebung geschieht, wird Harris‘ Projekt nicht der Schlüssel zur Erreichung des allgemeinen Wohlbefindens sein.
Harris ist sich bewusst, dass die äußeren Umstände eine wichtige Rolle für unser Wohlbefinden spielen, und er fasst einige Forschungsergebnisse zusammen, die sich mit diesen Faktoren befassen. Bei den meisten dieser Forschungen handelt es sich jedoch um „Soft Science“ der allerweichsten Art – Fragebogenerhebungen, bei denen Menschen in einer Vielzahl von Lebensumständen nach ihrem Glücksempfinden befragt werden. Wie Harris selbst feststellt, sagen uns die meisten Ergebnisse nichts, was wir nicht schon wussten. (Es überrascht nicht, dass Harris, ein atheistischer Polemiker, keine Studien anerkennt, die eine spirituelle oder religiöse Komponente des Glücks belegen). Darüber hinaus gibt es Grund zu der Frage, inwieweit das in Bevölkerungsumfragen selbst angegebene „Glück“ mit dem tatsächlichen Glück zusammenhängt. Jüngste Daten, die darauf hindeuten, dass sowohl Staaten als auch Länder mit einer hohen Rate an angegebenem „Glück“ auch eine hohe Selbstmordrate aufweisen, lassen vermuten, dass die Antworten der Menschen in Umfragen nicht immer ein zuverlässiger Indikator für das gesellschaftliche Wohlbefinden oder gar für Glück sind.
Auch dies ist ein Punkt, der so alt ist wie die Philosophie: Wie Aristoteles in der Nikomachischen Ethik feststellte, herrscht unter den Menschen große Uneinigkeit darüber, was Glück ist, „und oft identifiziert es sogar ein und derselbe Mensch mit verschiedenen Dingen, mit Gesundheit, wenn er krank ist, mit Reichtum, wenn er arm ist.“ Auch hier gilt, dass das Verständnis von Werten eine philosophische Betrachtungsweise erfordert und nicht einfach dadurch umgangen werden kann, dass man sie in ein numerisches Paket verpackt. Harris hat Recht, dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse unsere Entscheidungen beeinflussen können, indem sie unsere Anwendung moralischer Grundsätze erhellen – eine Schlussfolgerung, die Kant oder Aquin nicht beunruhigt hätte. Dies ist jedoch weit davon entfernt, dass wissenschaftliche Informationen unsere moralischen Grundsätze selbst formen oder bestimmen – eine Idee, für die Harris keine Argumente liefern kann.
Eine auffällige Ungereimtheit in Harris‘ Denken ist sein Festhalten am Determinismus, was im Widerspruch zu seinem Beharren darauf zu stehen scheint, dass es richtige und falsche Entscheidungen gibt. Diese Spannung ist in der Pop-Soziobiologie weit verbreitet. Harris scheint zu glauben, dass der freie Wille eine Illusion ist, aber auch, dass unsere Entscheidungen in Wirklichkeit von Gedanken gesteuert werden, die unaufgefordert in unseren Gehirnen entstehen. Er erklärt nicht, woher diese Gedanken kommen und wie sie mit moralischen Entscheidungen zusammenhängen.
Harris gibt einen Hinweis auf eine Antwort auf diese Frage, wenn er über Kriminelle spricht und deren Handlungen auf „eine Kombination aus schlechten Genen, schlechten Eltern, schlechten Ideen und Pech“ zurückführt. Jeder von uns, sagt er, „hätte im Leben ein ganz anderes Blatt bekommen können“, und „es scheint unmoralisch, nicht anzuerkennen, wie viel Glück an der Moral selbst beteiligt ist.“ Harris‘ Verweis auf „schlechte Gene“ bringt ihn näher an das Gebiet der Eugenik und des Sozialdarwinismus zurück, als ihm bewusst zu sein scheint, und macht Moral zum Privileg der wenigen Glücklichen. Obwohl Harris zugibt, dass wir noch viel darüber lernen müssen, was Glück ausmacht, vertritt er die Auffassung, dass glückliche Menschen „intellektuell anregende und finanziell lohnende Karrieren“ und „grundlegende Kontrolle über ihr Leben“ haben.
Diese Sichtweise untergräbt die Möglichkeit des Glücks und des moralischen Verhaltens für diejenigen, die schlechte Karten haben, und trägt somit auf individueller Ebene mehr zur Verschlechterung als zur Verbesserung bei. Noch schlimmer ist jedoch, dass sie dem Wohlergehen der Gesellschaft als Ganzes wenig zuträglich ist. Dass es wichtig ist, gute Bedingungen zu schaffen und diese für möglichst viele Menschen zu gewährleisten, ist bereits allgemein bekannt und anerkannt. Es stellt sich jedoch die Frage, wie diese Bedingungen für alle geschaffen werden können, und bisher wurde noch kein Wirtschaftssystem entwickelt, das dies gewährleistet. In Ermangelung dessen werden schwierige Diskussionen in der Philosophie, der Justiz, der Politik und all den anderen Bereichen, die sich mit dem öffentlichen Leben befassen, erforderlich sein, um zu verstehen, was das gute Leben ist und wie es angesichts der Beschränkungen und Ungleichheiten, die die Umstände jedem von uns bescheren, für viele ermöglicht werden kann. In diesen Punkten, wie auch in so vielen anderen, neigt der Szientismus dazu, kühne, neuartige Lösungen zu präsentieren, die in Wirklichkeit nur die Anfangsbuchstaben des Problems sind, wie es bereits allgemein verstanden wird.
Die Beständigkeit der Philosophie
Die positivistische Tradition in der Philosophie gab dem Szientismus einen starken Impuls, indem sie jedem Bereich des menschlichen Wissens außerhalb der Naturwissenschaften die Gültigkeit absprach. Die neueren Verfechter des Szientismus haben den ironischen, aber logischen nächsten Schritt getan, indem sie der Philosophie jegliche nützliche Rolle absprechen, selbst der unterwürfigen Philosophie der positivistischen Art. Der letzte Lacher bleibt jedoch den Philosophen vorbehalten, denn die Verfechter des Szientismus offenbaren begriffliche Verwirrungen, die bei philosophischer Betrachtung offensichtlich sind. Anstatt die Philosophie überflüssig zu machen, bereitet der Szientismus die Bühne für ihre dringend benötigte Wiederbelebung.
Die Verfechter des Szientismus beanspruchen heute den alleinigen Mantel der Rationalität und setzen die Wissenschaft häufig mit der Vernunft selbst gleich. Es scheint jedoch das genaue Gegenteil von Vernunft zu sein, darauf zu bestehen, dass die Wissenschaft etwas tun kann, was sie nicht kann, oder sogar, dass sie etwas getan hat, was sie nachweislich nicht getan hat. Als Wissenschaftler würde ich nie bestreiten, dass wissenschaftliche Entdeckungen wichtige Auswirkungen auf Metaphysik, Erkenntnistheorie und Ethik haben können und dass jeder, der sich für diese Themen interessiert, wissenschaftlich gebildet sein muss. Aber die Behauptung, dass die Wissenschaft und nur die Wissenschaft allein die seit langem bestehenden Fragen in diesen Bereichen beantworten kann, führt zu unzähligen Problemen.
Im Gegensatz zur Vernunft ist ein charakteristisches Merkmal des Aberglaubens das hartnäckige Beharren darauf, dass etwas – ein Fetisch, ein Amulett, ein Tarotkartenspiel – Kräfte besitzt, für die es keine Beweise gibt. Aus dieser Sicht hat der Szientismus mehr mit dem Aberglauben gemein als mit einer ordnungsgemäß durchgeführten wissenschaftlichen Forschung. Der Szientismus behauptet, dass die Wissenschaft bereits Fragen gelöst habe, zu deren Beantwortung sie von Natur aus nicht in der Lage ist.
Von allen Irrungen und Wirrungen in der langen Geschichte der menschlichen Leichtgläubigkeit scheint der Szientismus in all seinen verschiedenen Erscheinungsformen – von der phantasievollen Kosmologie bis hin zur evolutionären Erkenntnistheorie und Ethik – zu den gefährlichsten zu gehören, sowohl weil er vorgibt, etwas ganz anderes zu sein als das, was er wirklich ist, als auch weil ihm weithin und unkritisch gefolgt wird. Das fortgesetzte Beharren auf der universellen Kompetenz der Wissenschaft wird nur dazu dienen, die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft als Ganzes zu untergraben. Das Ergebnis wird ein zunehmender radikaler Skeptizismus sein, der die Fähigkeit der Wissenschaft in Frage stellt, selbst die Fragen zu beantworten, die legitimerweise in ihren Kompetenzbereich fallen. Man sehnt sich nach einer neuen Aufklärung, die die Anmaßungen dieses neuesten Aberglaubens durchbricht.
Austin L. Hughes ist Carolina Distinguished Professor für Biologische Wissenschaften an der Universität von South Carolina.